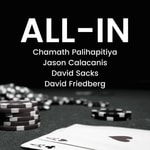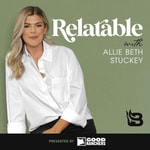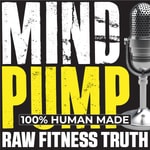Zukunft Denken – Podcast – Details, episodes & analysis
Podcast details
Technical and general information from the podcast's RSS feed.
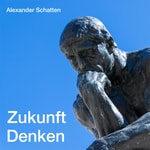
Zukunft Denken – Podcast
Alexander Schatten
Frequency: 1 episode/18d. Total Eps: 129

Recent rankings
Latest chart positions across Apple Podcasts and Spotify rankings.
Apple Podcasts
🇩🇪 Germany - science
05/07/2025#92🇩🇪 Germany - science
04/07/2025#88🇩🇪 Germany - science
30/06/2025#87🇩🇪 Germany - science
29/06/2025#69🇩🇪 Germany - science
28/06/2025#62🇩🇪 Germany - science
27/06/2025#61🇩🇪 Germany - science
26/06/2025#84🇩🇪 Germany - science
25/06/2025#100🇩🇪 Germany - science
24/06/2025#94🇩🇪 Germany - science
21/06/2025#100
Spotify
No recent rankings available
Shared links between episodes and podcasts
Links found in episode descriptions and other podcasts that share them.
See allRSS feed quality and score
Technical evaluation of the podcast's RSS feed quality and structure.
See allScore global : 62%
Publication history
Monthly episode publishing history over the past years.
116 — Science and Politics, A Conversation with Prof. Jessica Weinkle
Season 1 · Episode 116
lundi 27 janvier 2025 • Duration 53:09
Todays guest is Jessica Weinkle, Associate Professor of Public Policy at the University of North Carolina Wilmington, and Senior Fellow at The Breakthrough Institute.
In this episode we explore a range of topics and we start with the question: What is ecomodernism, and how does The Breakthrough Institute and Jessica interpret it?
“It's not a movement of can'ts”
Why are environmentalists selective about technology acceptance? Why do we assess ecological impact through bodies like the IPCC and frameworks like Planetary Boundaries? Are simplified indicators of complex systems genuinely helpful or misleading?
Is contemporary science more about appearances than substance, and do scientific journals serve more and more as advocacy platforms than fact-finding missions? How much should activism and science intersect? To what extent do our beliefs influence science, and vice versa, especially when financial interests are at play in fields like climate science? Can we trust scientific integrity when narratives are tailored for publication, like in the case of Patrick Brown?
What responsibilities do experts have when consulting in political spheres, and should they present options or advocate for specific actions? How has research publishing turned into big business, and what does this mean for the pursuit of truth?
“Experts should always say: here are your options A, B, C...; not: I think you should do A”
How does modeling shape global affairs? When we use models for decision-making, are we taking them too literally, or should we focus on their broader implications?
“To take a model literally is not to take it seriously […] the models are useful to give us some ideas, but the specificity is not where we should focus.”
What's the connection between scenario building, modeling, and risk management?
“There is an institutional and professional incentive to make big claims, to draw attention. […] That's what we get rewarded for. […] It does create an incentive to push ideas that are not necessarily the most helpful ideas for addressing public problems.”
How does the public venue affect scientists, and does the incentive to make bold claims for attention come at the cost of practical solutions? What lessons should we have learned from cases like Jan Hendrik Schön, and why haven't we?
“There is an underappreciation for the extent to which scholarly publishing is a business, a big media business. It's not just all good moral virtue around skill and enlightenment. It's money, fame and fortune.”
Finally, are narratives about future scenarios fueling climate anxiety, and how should we address this in science communication and policy-making?
“There is a freedom in uncertainty and there is also an opportunity to create decisions that are more robust to an unpredictable future. The more that we say we are certain ... the more vulnerable we become to the uncertainty that we are pretending is not there.”
Other Episodes
- Episode 109: Was ist Komplexität? Ein Gespräch mit Dr. Marco Wehr
- Episode 107: How to Organise Complex Societies? A Conversation with Johan Norberg
- Episode 90: Unintended Consequences (Unerwartete Folgen)
- Episode 86: Climate Uncertainty and Risk, a conversation with Dr. Judith Curry
- Episode 79: Escape from Model Land, a Conversation with Dr. Erica Thompson
- Episode 76: Existentielle Risiken
- Episode 74: Apocalype Always
- Episode 70: Future of Farming, a conversation with Padraic Flood
- Episode 68: Modelle und Realität, ein Gespräch mit Dr. Andreas Windisch
- Episode 60: Wissenschaft und Umwelt — Teil 2
- Episode 59: Wissenschaft und Umwelt — Teil 1
References
- Jessica Weinkle
- The Breakthrough Journal
- Planetary Boundaries (Stockholm Resilience Centre)
- Patrick T. Brown, I Left Out the Full Truth to Get My Climate Change Paper Published, The FP (2023)
- Roger Pielke Jr., What the media won't tell you about . . . hurricanes (2022)
- Roger Pielke Jr., "When scientific integrity is undermined in pursuit of financial and political gain" (2023)
- Many other excellent articles Roger Pielke on his Substack The Honest Broker
- Jessica Weinkle, Model me this (2024)
- Jessica Weinkle, How Planetary Boundaries Captured Science, Health, and Finance (2024)
- Jessica Weinkle, Bias. Undisclosed conflicts of interest are a serious problem in the climate change literature (2025)
- Marcia McNutt, The beyond-two-degree inferno, Science Editorial (2015)
- Scientific American editor quits after anti-Trump comments, Unherd (2024)
- Erica Thompson, Escape from Model Land, Basic Books (2022)
115 — Fragen über Fragen
Season 1 · Episode 115
mardi 7 janvier 2025 • Duration 21:19
Jahresrückblicke finde ich eher langweilig; jeder weiß, was im letzten Jahr passiert ist. Für mich ist es viel spannender zu reflektieren, was wir aus dem vergangenen Jahr lernen können. Welche Irrtümer haben wir gemacht, welche eigenen Ideen wurden in Frage gestellt? Welche neuen Fragen stellen sich und welche werden entscheidend für das kommende Jahr sein? Fragen scheinen mir konstruktiver zu sein als Antworten, da sie das Denken leiten und zu Diskussionen und Widersprüchen einladen, ohne die Antworten vorwegzunehmen.
Diese Episode widmet sich genau diesen Fragen und Themen, die besonders in den Episoden des letzten Jahres diskutiert wurden. Beginnen wir mit den »Strukturen des Versagens«. Nach Rory Sutherland kann das Gegenteil von gut ebenfalls gut sein. Das Gegenteil von schlecht hingegen ist oft noch schlechter. Die »Contrarian« Position ist keine stabile Basis zur Wahrheitsfindung. Nur durch ehrliche Auseinandersetzung und stetigen kritischen Diskurs können wir der Wahrheit näherkommen. Wir können die Realität ignorieren, aber nicht die Folgen dieses Ignorierens – ein Phänomen, das in den nächsten Jahren in Europa besonders bitter werden könnte, wenn wir weiterhin politisches oder aktivistisches Wunschdenken über die Realität stellen.
Ein weiteres Thema ist, was die Legacy-Medien ersetzen wird. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass traditionelle Medien an journalistischem Wert und Bedeutung verloren haben. Die US-Wahlen wurden durch Podcasts und soziale Medien beeinflusst, und in Europa könnten ähnliche Überraschungen folgen. Aber was sollte diese Systeme ersetzen?
Weiters haben wir diskutiert, ob mehr Wissenschaftler wirklich zu besserer Wissenschaft führen. Es gibt Anzeichen für Marktverzerrungen in der Wissenschaft, was zu kurzfristigen Zielen und Stagnation führt. Wie sollte Wissenschaftsförderung stattfinden, zumal der aktuelle Zustand nicht zufriedenstellend ist?
Komplexität und Resilienz sind ein weiteres Thema. Der Irrglaube, dass komplex gleich fragil ist, wird von der Natur widerlegt, die komplex und zugleich, oder gerade deshalb (?) resilient ist. Menschliche Systeme hingegen scheinen oft durch Komplexität fragil zu werden. Welche Faktoren machen ein komplexes System resilient oder fragil?
Ein weiterer Punkt ist das Konzept von Skin in the Game gegenüber Risikovermeidung. Gesellschaften brauchen Menschen, die kluge Risiken eingehen — Unternehmer, Innovatoren, Wissenschaftler. Doch wie kann man Risikobereitschaft fördern, wenn diese Risiken das eigene Leben zerstören können?
Schließlich diskutieren wir den Liberalismus, die Freiheit und die Organisation komplexer Gesellschaften. Zentrale Lösungen für komplexe Probleme scheitern erwartungsgemäß. Kann und sollte man dysfunktionale Systeme reformieren oder ist ein Neuanfang nötig?
Wie erwachsen sind Erwachsene wirklich und wie viel Selbstverantwortung kann man von ihnen in einer komplexen Gesellschaft erwarten?
Schreiben Sie mir Ihre Gedanken dazu – Diskussion und Widerspruch sind herzlich willkommen.
In diesen Shownotes gibt es keine Referenzen. Sie beziehen sich auf die Episoden des letzten Jahres.
106 — Wissenschaft als Ersatzreligion? Ein Gespräch mit Manfred Glauninger
Season 1 · Episode 106
mardi 27 août 2024 • Duration 01:11:55
Das heutige Gespräch führe ich mit Dr. Manfred Glauninger. Er ist Soziolinguist und forscht am Austrian Centre for Digital Humanities and Cultural Heritage der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und lehrt am Institut für Germanistik der Universität Wien.
Dieses Gespräch war für mich ganz besonders interessant und auch unterhaltsam, weil wir eine ganze Reihe von Dingen miteinander verbunden haben, die schon in früheren Episoden erwähnt wurden.
Was ist Wissenssoziologie, warum muss Wissenschaft auch als soziales Phänomen verstanden werden? Ist es gefährlich oder notwendig, Wissenschaft zu entmystifizieren und auch hart zu kritisieren? Wirkt Wissenschaft in manchen Bereichen unserer Gesellschaft gar als Ersatzreligion? Was sind die Auswirkungen davon?
Was lernen wir aus den schweren Krisen der letzten 20 Jahren und dem regelmäßigen Versagen von Institutionen über die Rolle der Wissenschaft?
Wie läuft die Produktion von Wissen ab? Welche »magischen« Mechanismen gibt es hier, oder verhält es sich letztlich ähnlich wie die Produktion zahlreicher anderer Güter? Was hat es mit Fehlern und Inkompetenz auf sich? Gibt es unterschiedliche Arten von Fehlern?
Gibt es eine frühe »Prägung« des Nachwuchses in der Wissenschaft, gepaart mit starken Hierarchien und Gerontokratie? Welche Rolle spielt Wettbewerb gegenüber Kooperation in der Wissenschaft? Richten wir die Wissenschaft zu sehr nach marktwirtschaftlichen Prinzipien aus, oder besser gesagt: spielt die Wissenschaft Marktwirtschaft, weil weder die Akteure dafür die Kompetenz haben, noch das Modell passt?
In einigen anderen Folgen wurde das Thema Stagnation schon angesprochen, auch hier stellen wir die Frage: Verdoppelt sich das Wissen oder eher Rauschen regelmäßig? Eine in diesem Zusammenhang für die Gesellschaft sehr relevante Frage ist, welchen Beitrag die immer größere Zahl an wissenschaftlich ausgebildeten Menschen tatsächlich für unsere Gesellschaft leisten? Welche Rolle spielt eben diese wissenschaftliche Ausbildung dabei? Bringt die universitäre Ausbildung tatsächlich signifikante Gewinne für unsere Gesellschaft oder dominiert Signalisierung über Substanz? Der US-amerikanische Ökonom, dessen Name mir in der Episode nicht eingefallen war, ist Bryan Kaplan, der selbst an der George Mason Eliteuniversität forscht und unterrichtet.
»My best guess says signaling accounts for 80% of education’s return”«, Bryan Kaplan
Die Idee der Signalisierung und sollte mit der schon genannten der Frage nach der Qualität der Bildung in unseren Institutionen verknüpft werden, besonders hinsichtlich der nur verbleibenden 20% :
»Teachers’ plea that “we’re mediocre at teaching what we measure, but great at teaching what we don’t measure” is comically convenient.«, Bryan Kaplan
Auch zwischen den Studienrichtungen gibt es Unterschiede. Gilt die Geisteswissenschaft immer häufiger als Notnagel für diejenigen, die schwierigere Studien nicht schaffen? In einer früheren Episode hat bereits Prof. Michael Sommer ähnliche Aussagen getätigt.
“The excentric university professor is a species that is going to be extinct fast. […] The bad currency is driving out the good and in effect where the people who are nimble in the art of writing for grants are displacing the idiosyncratic thinkers who are generally much less nimble at that sort of activity.”, Peter Thiel
Peter Thiel bietet sogar ein Stipendium für diejenigen an, die »Dinge bauen wollen, anstatt im Klassenzimmer zu sitzen.«
Damit stellt sich eine noch grundlegendere Frage: Stellen viele Fächer so etwas wie eine institutionelle Autopoiesis dar, ist es also Wissenschaft als selbstreferenzielle Legitimation ihrer eigenen Institutionen, weil sie keinen direkt erkennbaren Nutzen haben? Aber die Frage kann auch umgedreht werden: Was richtet Institutionalisierung mit Wissenschaft an?
Als »Berufsdenker« sollte auch die Selbstreflexion hoch im Kurs stehen, warum hört man dann so wenig davon in der Öffentlichkeit, im Besonderen nach großen Krisen?
Wie kann das Zusammenspiel zwischen Politik und Wissenschaft beschrieben werden? Kann Wissenschaft tatsächlich nur in Demokratien das volle Potenzial ausspielen?
»Macht ist ein wichtiger Punkt in der Wissenschaft.«
Was können wir hier aus der Vergangenheit lernen, etwa der Wissenschaft während der Nazi-Diktatur in Deutschland und Österreich?
»Lawyers and doctors, all credentialed with university degrees, were substantially overrepresented within the NSDAP, as were university students (then a far narrower section of society than today)«, Niall Ferguson
Benötigen wir überhaupt so viele Akademiker in unserer Gesellschaft? Der deutsche Philosoph Julian Nida-Rümelin spricht vom Akademisierungswahn. Der damalige britische Premierminister Rishi Sunak warnt, dass zu vielen Universitätsstudenten ein falscher Traum verkauft werde. Auch Thomas Sowell kritisiert die eindimensionale Betrachtung des Wissensbegriffs:
»Someone who is considered to be a “knowledgeable” person usually has a special kind of knowledge—perhaps academic or other kinds of knowledge not widely found in the population at large. Someone who has even more knowledge of more mundane things—plumbing, carpentry, or automobile transmissions, for example—is less likely to be called “knowledgeable” by those intellectuals for whom what they don’t know isn’t knowledge. Although the special kind of knowledge associated with intellectuals is usually valued more, and those who have such knowledge are usually accorded more prestige, it is by no means certain that the kind of knowledge mastered by intellectuals is necessarily more consequential in its effects in the real world.«, Thomas Sowell
Absolventen von Universitäten müssen aber auch als Denkkollektiv gesehen werden. Ist dies aber ein Kollektiv, wo Diversität nur auf der Verpackung steht?
Wer ist überhaupt Innovator in unseren modernen Gesellschaften?
»But just as most engineers are not inventors, and most scientists are not researchers, so most science is not research. […] The university was keeping up with a changing technological world rather than creating it.«, David Edgerton
Was hat es also mit Kreativität im Wissenschaftsbetrieb, im Kollektiv zu tun? Hat zumindest eine kleine Minderheit noch die Chance, sich einen Freiraum zu schaffen, den die Institution (noch) nicht erkannt und durch Prozesse und Regeln ausradiert hat.
Zuletzt kehren wir zur Frage zurück, wie Krise und Expertise zusammenwirken. Was sind die zwei wichtigsten Aussagen, die Sie von jedem Experten hören sollten, aber selten hören? Dr. Glauninger wird es am Ende der Episode enthüllen.
“Evidence based policy has become policy based evidence.”, Mervyn King
Referenzen
Andere Episoden
- Episode 101: Live im MQ, Macht und Ohnmacht in der Wissensgesellschaft. Ein Gespräch mit John G. Haas.
- Episode 96: Ist der heutigen Welt nur mehr mit Komödie beizukommen? Ein Gespräch mit Vince Ebert
- Episode 93: Covid. Die unerklärliche Stille nach dem Sturm. Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
- Episode 92: Wissen und Expertise Teil 2
- Episode 80: Wissen, Expertise und Prognose, eine Reflexion Teil 1
- Episode 91: Die Heidi-Klum-Universität, ein Gespräch mit Prof. Ehrmann und Prof. Sommer
- Episode 85: Naturalismus — was weiß Wissenschaft?
- Episode 84: (Epistemische) Krisen? Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
- Episode 83: Robert Merton — Was ist Wissenschaft?
- Episode 72: Scheitern an komplexen Problemen? Wissenschaft, Sprache und Gesellschaft — Ein Gespräch mit Jan David Zimmermann
- Episode 71: Stagnation oder Fortschritt — eine Reflexion an der Geschichte eines Lebens
- Episode 44: Was ist Fortschritt? Ein Gespräch mit Philipp Blom
- Episode 41: Intellektuelle Bescheidenheit: Was wir von Bertrand Russel und der Eugenik lernen können
- Episode 39: Follow the Science?
- Episode 38: Eliten, ein Gespräch mit Prof. Michael Hartmann
- Episode 28: Jochen Hörisch: Für eine (denk)anstössige Universität!
- Episode 18: Gespräch mit Andreas Windisch: Physik, Fortschritt oder Stagnation
Dr. Manfred Glauninger
Fachliche Referenzen
- John P. A. Ioannidis, Why Most Published Findings Are False (2005)
- Sabine Kleinert, Richard Horton, How should medical science change? Lancet Comment (2014)
- Ludwig Fleck, Genesis and development of a scientific fact. ed. T.J. Trenn and R.K. Merton, foreword by Thomas Kuhn. Chicago : University of Chicago Press, 1979. This is the first English translation of his 1935 book titled Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollectiv. Basel: Schwabe und Co
- Bryan Kaplan, The Case against Education, Princeton University Press (2018)
- Conversation between Peter Thiel und David Graeber, Where did the Future go? (2020)
- Peter Thiel Fellowship
- Niall Ferguson, The Treason of the Intellectuals, The Free Press (2023)
- Niall Ferguson, The Treason of the Intellectuals, Uncommon Knowledge with Peter Robinson (2024)
- Julien Benda, La trahison des clercs (1927)
- Julian Nida Rümelin, Der Akademisierungswahn, Vortrag Körber-Stiftung (2014)
- Thomas Sowell, intellectuals and Society, Basic Books (2010)
- Rishi Sunak, Too Many University Students are Sold a False Dream, Telegraph (2023)
- David Edgerton, The Shock Of The Old: Technology and Global History since 1900, Profile Books (2019)
- Mervyn King, John Kay, Radical Uncertainty, Bridge Street Press (2021)
- Karl Popper, Die offene Gesellschaft und ihre Feinde
017 – Kooperation
Season 1 · Episode 17
dimanche 19 janvier 2020 • Duration 18:15
Essen oder gegessen werden – wir bereiten unsere Kinder, jungen Erwachsenen und Studenten auf eine Welt des Wettbewerbes vor. Homo Homini Lupus im modernen Gewande.
Aber passt dies überhaupt zu den Problemen der heutigen Zeit? Ist diese Ideologie die richtige um tatsächlich Fortschritt zu erzielen?
»Marx: alle Sinne reduzieren sich auf das Haben. Solidarität wird ersetzt durch egoistische Konkurrenz und Macht.«, Michael Quante
Zwei Seiten einer Medaille als Kontext: »Die Tragödie des Menschen und der Allmende«.
Eineseits sprechen wir, nach Arnold Gehlen, über den Mensch als Mängelwesen, das aber über die Fähigkeit der Kooperation zur dominierenden Spezies des Planeten geworden ist, andererseits Garrett Hardin, tragedy of the commons – wo das bisherige Ende dieser Kooperation zu erkennen war. Natürliche Ressourcen werden bis zum Kollaps zerstört.
Kooperation in modernem Gewande, nicht Wettbewerb, hat in der Vergangenheit zu enormen Leistungen verholfen, denken wir an die Mondlandung, das Manhatten Projekt, den Umgang mit SARS, AIDS oder dem Ozonloch.
Aber dort, wo es heute am wichtigsten ist, zum Beispiel dem Klimawandel, kommen wir nicht voran.
Wie kann eine kooperative Nutzung wesentlicher Ressourcen in der Zukunft aussehen? Welche Rolle spielen moderne Technologien wie die künstliche Intelligenz?
Andere Episoden:
- Episode #3: Unerwartete Konsequenzen, das Ozonloch
- Episode #6: Messen was messbar ist
- Episode #16: Innovation und Fortschritt oder Stagnation
Referenzen
- Michael Quante, Das philosophische Radio, WDR5, 3.1.2020
- Der Mensch als Mängelwesen, NZZ 24.01.2004
- Klaus Kornwachs, Philosophie der Technik (C.H.Beck Wissen) (2013)
- Teller und Oppenheimer, Das Ende der Welt?
- Nassim Taleb, Skin in the Game (2018)
- Keith Carlisle, Rebecca L. Gruby, Polycentric Systems of Governance: A Theoretical Model for the Commons, The Policy Studies Journal, Vol. 00, No. 00, 2017
- Seven principles of resilience, Stockholm Resilience Centre
016 – Innovation und Fortschritt oder Stagnation?
Season 1 · Episode 16
vendredi 3 janvier 2020 • Duration 38:47
»Überhaupt hat der Fortschritt das an sich, daß er viel größer ausschaut, als er wirklich ist.«, Johann Nestroy
In der vorigen Episode habe ich versucht das Zusammenspiel von Innovation und Fortschritt unter die Lupe zu nehmen. Ziel war es zum Nachdenken und vor allem auch zum Widerspruch anzuregen. Ich freue mich auch weiterhin über Anregungen und Kommentare.
In dieser Episode gehe ich einen – etwas spekulativen – Schritt oder Frage weiter. Scheitern wir vielleicht nicht nur daran zwischen Innovation und Fortschritt zu unterscheiden, sondern ist das Problem vielleicht wesentlich tiefer liegend: leben wir in einem Zeitalter der Stagnation, wo zwar viel Lärm gemacht wird, sich tatsächlich aber recht wenig bewegt?
Ein Blick zurück. Philipp Blom beschreibt die tatsächlich enormen Umwälzungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Als bemerkenswertes Beispiel greife ich die Neurasthenie heraus, die zeigt, als wie schnell und überwältigend diese Entwicklungen wahrgenommen wurden. Blom zitiert einen George Miller Beard, Art der Zeit:
»Es gibt eine große Familie von funktionellen nervösen Störungen, die unter den hinter verschlossenen Türen arbeitende Klassen der zivilisierten Länder immer häufiger werden. In diesem Land beträgt die Anzahl der Menschen, die an dieser Krankheit leiden, Hunderttausende«
In der Tat ist auch objektiv eine enorme Entwicklung in Wissenschaft, Technik und Gesellschaft zwischen 1900 und 1960 zu beobachten.
In einem Gespräch kommen Peter Thiel, Eric Weinstein zu der Erkenntnis, dass wir in einem Zeitalter der Stagnation (seit den 1970er Jahren) leben; mit wenigen Ausnahmen (vor allem Informationstechnologie uns Software). Stagnation in der Wissenschaft, der Technologie aber auch kaum Wirtschaftswachstum. Volatität wird als Dynamik missverstanden.
Der absolut überwiegende Teil der wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen auch der heutigen Zeit wurden vor den 1970er Jahren gelegt.
Haben wir ein Problem in der Wissenschaft (ist es ein fundamentales Erkenntnisproblem, oder eines der wissenschaftlichen Praxis)? in der Umsetzung in die Technologie? In unseren Organisationen?
»Wir leben in einer Art von intellektuellen Truman-Show, wo alles um uns herum falsch ist und etwas super-aufregendes passieren wird.«, Eric Weinstein
Thiel und Weinstein sind nicht die einzigen, die derartige Ideen vertreten: Artikel von Frank Schirrmacher und David Graeber sowie ökonomische Aspekte durch Robert Gordon: keine nennenswerte Zunahme an Produktivität, Innovation und Wachstum in den letzten Jahrzehnten.
Zuletzt werfen wir einen Blick auf die sehr interessanten Beobachtungen der Physikerin Sabine Hossenfelder, die ähnliche Beobachtungen aus der Innensicht der modernen (theoretischen) Physik macht.
»Meine Generation ist bemerkenswert erfolglos – in mehr als 30 Jahren ist es uns nicht gelungen, die Grundlagen der Physik zu verbessern«
Aber so erfolglos können wir gar nicht sein, dass wir die Lautstärke des Marketings nicht ständig aufdrehen.
Stimmt es also, dass wir – entgegen dem lautstarken Marketing – tatsächlich eher in einer Welt der wissenschaftlichen und technologischen Stagnation leben?
Und falls das so ist: warum ist das für unsere Gesellschaft und Zukunft von größter Bedeutung!?
Wie immer: schicken Sie mir Ihre Meinungen, Kritikpunkte, Ergänzungen, z.B. über Twitter, und über dieses Feedback-Formular.
Referenzen
- Philipp Blom, Der taumelnde Kontinent: Europa 1900–1914 (2011)
- The Portal: Eric Weinstein, Peter Thiel (im besonderen die ersten 30–40 Minuten)
- David Graeber im Gespräch mit Peter Thiel, Where did the future go?
- Frank Schirrmacher, Neil Armstrongs Epoche: Das Drama einer Enttäuschung (FAZ) (ca. 2012)
- Klaus Kornwachs, Philosophie der Technik (C.H.Beck Wissen) (2013)
- Antibiotika: Das Wundermittel wirkt nicht mehr, ZEIT Online
- Missing Link: Der 3D-Drucker, oder: die industrielle Revolution, die nicht stattfand
- David Graeber, Bürokratie, Die Utopie der Regeln (2017)
- Robert Gordon, The death of innovation, the end of growth (TED-Talk)
- Sabine Hossenfelder, Lost in Math
- Konrad Paul Liessmann, Dienst ohne Vorschrift – 200 Jahre nach seinem Tod wäre Immanuel Kant, einer der größten Denker der Moderne, chancenlos, sich im heutigen Wissenschaftsbetrieb durchzusetzen. Der Standard, 6. Februar 2004
- Edward Snowden, Permanent Record (2019)
- Tim Jackson, Prosperity without Growth (2009, 2016)
015 – Innovation oder Fortschritt?
Season 1 · Episode 15
mardi 17 décembre 2019 • Duration 32:40
Wir sprechen in der Öffentlichkeit, in der Wissenschaft, der Industrie ständig von Innovation, so als wäre Innovation per se sinnvoll und wichtig für unsere Gesellschaft, aber stimmt das? Was ist überhaupt Innovation? Und was ist der Unterschied oder Zusammenhang zwischen Innovation und Fortschritt?
Warum sprechen wir davon in letzter Zeit immer weniger von Fortschritt? Es gab mehr als ein Anzeichen in der Vergangenheit, dass Innovation und Fortschritt nicht immer Hand in Hand gehen müssen, und in der heutigen Zeit und damit auch in der nahen Zukunft ist die Situation noch komplizierter geworden.
»Mit dem 18. und 19. Jahrhundert wird der Begriff des Fortschritts fester Bestandteil des europäischen Weltbildes.«, Klaus Kornwachs
Wir hat sich der Fortschrittsbegriff des 19. Jahrhunderts immer mehr auf Innovation reduziert?
Wir werfen einen Blick in die Vergangenheit, unter anderem auf den »Atommoment« der Physiker, den Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki und stellen uns die Frage, ob wir heute nicht einen »Atommoment« der Informatik erleben.
War das alles unvorhersehbar?
Was hat die Technikkritik der Nachkriegszeit bewirkt, denken wir etwa an Günther Anders:
»Wir sind die Herren der Apokalypse, das Unendliche sind wir. Alle Wechselfälle der (bisherigen) Geschichte werden angesichts der neuen Möglichkeiten zur reinen “Vorgeschichte”«
Es herrscht nach dem zweiten Weltkrieg wohl eher das Motte »Machen was machbar ist«. Seit damals scheinen wir die Frage nach dem Fortschritt immer weniger zu stellen und heute werden wir mit Innovationen auf allen Ebenen überflutet.
»In den letzten vierzig Jahren hat sich das Pro-Kopf-Einkommen der US-Amerikaner mehr als verdoppelt. Bedeutet dies, dass wir mehr glückliche Menschen haben? Keineswegs. Noch deutlicher ist des in Japan, wo sich das Pro-Kopf-Einkommen in den letzten vierzig Jahren verfünffacht hat, wieder: mit keinem messbaren Zuwachs an individuellem Glück«, Barry Schwartz
Also doch eher Ablenkung und Nebelkerzen um uns von den tatsächlichen Problemen der Zeit abzulenken?
»Wir verwechseln systematisch Innovation mit Fortschritt«, Harald Welzer
Es mangelt nicht an Herausforderungen. Sollten wir »Innovation« nicht eher als Ablenkung begreifen, ad acta legen und uns dem Begriff des Fortschrittes wieder annähern um die Probleme der Zeit handhaben zu können?
Referenzen
- Richard von Schirach, Die Nacht der Physiker, Rowohlt (2012)
- Armin Hermann, Die Jahrhundertwissenschaft, Werner Heisenberg und die Geschichte der Atomphysik, Rowohlt (1977)
- Klaus Kornwachs, Philosophie der Technik (C.H.Beck Wissen) (2013)
- Ludwig Fahrbach, How the growth of science ends theory change, Synthese (2011) 180: 139.
- Günther Anders, Die Antiquiertheit des Menschen Buch 1 und 2, Beck (2010)
- Edward Snowden, Permanent Record, Macmillan (2019)
- Atul Gawande, What matters in the end?, On Being Podcast
- Sabine Hossenfelder, Lost in Math (2018)
- Barry Schwartz, The Paradox of Choice, HarperCollins (2016)
- Der Philosophische Stammtisch: Schöne neue digitale Welt? (mit Precht, Welzer & Gentinetta) (2018)
- Shoshanna Zuboff, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus (2018)
- Rushkoff, Douglas. Present Shock: When Everything Happens Now, Penguin Publishing Group (2014)
- Thomas Bauer, Die Vereindeutigung der Welt, Reclam (2018)
014 - (Pseudo)wissenschaft? Welcher Aussage können wir trauen? Teil 2
Season 1 · Episode 14
mardi 26 novembre 2019 • Duration 27:28
Zweiter Teil der Fragestellung: Was ist Pseudowissenschaft und wie grenzt sie sich von »richtiger« Wissenschaft ab. Und außerdem: warum ist das überhaupt wichtig? Wem und welcher Aussage können wir vertrauen?
Eine Abgrenzung ist aus philosophischer Sicht interessant, aus wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht wichtig. Ohne eine einigermaßen saubere Trennung besteht die Gefahr dass wir
- unsere Aufmerksamkeit und Zeit verschwenden
- sachliche falsche politische Entscheidungen treffen
- viel Geld verschwendet und Leid angerichtet wird
- Menschen werden betrogen oder getäuscht werden
Anhand einiger Beispiele wie Astronomie im Vergleich zu Astrologie, Anthroposophie, Homöopathie, Kreationismus und anderen werden die Prinzipien erklärt.
Die Abgrenzung ist aber alles andere als einfach. Zunächst werden elementare Prinzipien moderner Naturwissenschaften angesprochen, wie die Idee des Naturalismus aber auch die Frage, wo die Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis liegen können. Dann gehen wir auf einige fundamentale philosophische Kriterien wissenschaftlicher Aussagen ein, wie:
- Ockhams Rasiermesser
- Gültigkeit von wissenschaftlichen Aussagen
- Induktion und Deduktion (oder: wie kommen wir zu Gesetzmäßigkeiten und wie wenden wir diese an?)
- Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit (auch mit der Idee des Falsifikationsimsus)
- und nicht zuletzt: wie prüfen wir Behauptungen?
»In früheren Zeiten wurde der Träger der Theorie ausgeschieden. Jetzt können wir unsere Theorien an unserer Statt für uns sterben lassen.«, Karl Popper
Wir werden aber auch feststellen, dass in den modernen, komplexen und stark vernetzten Wissenschaften, einfache Ansätze nicht mehr ohne weiteres gültig sind – wie kommen wir hier voran? Eine wesentliche Indikation hat der Philosoph Betrand Russel schon vor längerer Zeit gegeben:
»Wissenschaft hat, seit der Zeit der arabischen Wissenschaft zwei Funktionen, sie ermöglicht uns Dinge zu wissen und sie ermöglicht uns Dinge zu tun«, Betrand Russel
Nach diesen sehr prinzipiellen Fragen kommen wir zu ganz konkreten und praktischen Anhaltspunkten, wie es uns auch als »normalen« Menschen ganz praktisch gelingen kann, glaubwürdige Aussagen und Systeme von unglaubwürdigen Pseudowissenschaften zu unterscheiden. Angesichts der anstehenden Herausforderungen und Probleme scheint dies von größter Bedeutung zu sein um unsere Kräfte in die richtige Richtung zu lenken.
Referenzen
Philosophische Betrachtungen
- Alan Chalmers, What is this thing called science, Open University Press (2013)
- Adam Morton, A Guide Through the Theory of Knowledge
- Carol Tavris, Elliot Aronson, Mistakes Were Made (But Not by Me): Why We Justify Foolish Beliefs, Bad Decisions, and Hurtful Acts
- Massimo Pigliucci, Nonsense on Stilts
- Karl Popper, Alles Leben ist Problemlösen
- Karl Popper, Auf der Suche nach einer besseren Welt
- Bertrand Russell, The Impact of Science on Society
- Stanford Encyclopaedia on Philosophy, Pseudoscience
- Mario Bunge, Finding Philosophy in Social Science. New Haven, CT: Yale University Press (1996)
Skeptische Literatur
- Carl Sagan, The Demon Haunted World
- Believing Scripture but Playing by Science’s Rules, New York Times, Feb. 12, 2007
- How Reliable are Psychological Studies?, The Atlantic (2015)
- Reproducibility Project: Psychology
- Astrologie
- Peter Hartmann, Martin Reuter, Helmuth Nyborg, The relationship between date of birth and individual differences in personality and general intelligence: A large-scale study, Personality and Individual Differences 40 (2006) 1349–1362
- PSIRAM Wiki zu Astrologie
Medizin
- Ethnic difference
- Autismus und Impfung (Wakefield Studie)
- Johan Hari, Lost Connection. Uncovering the Real Causes of Depression and the Unexpected Solutions
013 - (Pseudo)wissenschaft? Welcher Aussage können wir trauen? Teil 1
Season 1 · Episode 13
mardi 12 novembre 2019 • Duration 38:13
Erster Teil der Fragestellung: Was ist Pseudowissenschaft und wie grenzt sie sich von »richtiger« Wissenschaft ab. Und außerdem: warum ist das überhaupt wichtig? Wem und welcher Aussage können wir vertrauen?
Eine Abgrenzung ist aus philosophischer Sicht interessant, aus wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Sicht wichtig. Ohne eine einigermaßen saubere Trennung besteht die Gefahr dass wir
- unsere Aufmerksamkeit und Zeit verschwenden
- sachliche falsche politische Entscheidungen treffen
- viel Geld verschwendet und Leid angerichtet wird
- Menschen werden betrogen oder getäuscht werden
Anhand einiger Beispiele wie Astronomie im Vergleich zu Astrologie, Anthroposophie, Homöopathie, Kreationismus und anderen werden die Prinzipien erklärt.
Die Abgrenzung ist aber alles andere als einfach. Zunächst werden elementare Prinzipien moderner Naturwissenschaften angesprochen, wie die Idee des Naturalismus aber auch die Frage, wo die Grenzen der wissenschaftlichen Erkenntnis liegen können. Dann gehen wir auf einige fundamentale philosophische Kriterien wissenschaftlicher Aussagen ein, wie:
- Ockhams Rasiermesser
- Gültigkeit von wissenschaftlichen Aussagen
- Induktion und Deduktion (oder: wie kommen wir zu Gesetzmäßigkeiten und wie wenden wir diese an?)
- Nachvollziehbarkeit und Prüfbarkeit (auch mit der Idee des Falsifikationsimsus)
- und nicht zuletzt: wie prüfen wir Behauptungen?
»In früheren Zeiten wurde der Träger der Theorie ausgeschieden. Jetzt können wir unsere Theorien an unserer Statt für uns sterben lassen.«, Karl Popper
Wir werden aber auch feststellen, dass in den modernen, komplexen und stark vernetzten Wissenschaften, einfache Ansätze nicht mehr ohne weiteres gültig sind – wie kommen wir hier voran? Eine wesentliche Indikation hat der Philosoph Betrand Russel schon vor längerer Zeit gegeben:
»Wissenschaft hat, seit der Zeit der arabischen Wissenschaft zwei Funktionen, sie ermöglicht uns Dinge zu wissen und sie ermöglicht uns Dinge zu tun«, Betrand Russel
Nach diesen sehr prinzipiellen Fragen kommen wir zu ganz konkreten und praktischen Anhaltspunkten, wie es uns auch als »normalen« Menschen ganz praktisch gelingen kann, glaubwürdige Aussagen und Systeme von unglaubwürdigen Pseudowissenschaften zu unterscheiden. Angesichts der anstehenden Herausforderungen und Probleme scheint dies von größter Bedeutung zu sein um unsere Kräfte in die richtige Richtung zu lenken.
Referenzen
Philosophische Betrachtungen
- Alan Chalmers, What is this thing called science, Open University Press (2013)
- Adam Morton, A Guide Through the Theory of Knowledge
- Carol Tavris, Elliot Aronson, Mistakes Were Made (But Not by Me): Why We Justify Foolish Beliefs, Bad Decisions, and Hurtful Acts
- Massimo Pigliucci, Nonsense on Stilts
- Karl Popper, Alles Leben ist Problemlösen
- Karl Popper, Auf der Suche nach einer besseren Welt
- Bertrand Russell, The Impact of Science on Society
- Stanford Encyclopaedia on Philosophy, Pseudoscience
- Mario Bunge, Finding Philosophy in Social Science. New Haven, CT: Yale University Press (1996)
Skeptische Literatur
- Carl Sagan, The Demon Haunted World
- Believing Scripture but Playing by Science’s Rules, New York Times, Feb. 12, 2007
- How Reliable are Psychological Studies?, The Atlantic (2015)
- Reproducibility Project: Psychology
- Astrologie
- Peter Hartmann, Martin Reuter, Helmuth Nyborg, The relationship between date of birth and individual differences in personality and general intelligence: A large-scale study, Personality and Individual Differences 40 (2006) 1349–1362
- PSIRAM Wiki zu Astrologie
Medizin
- Ethnic difference
- Autismus und Impfung (Wakefield Studie)
- Johan Hari, Lost Connection. Uncovering the Real Causes of Depression and the Unexpected Solutions
012 - Wie wir die Zukunft entdeckt und wieder verloren haben
Season 1 · Episode 12
jeudi 17 octobre 2019 • Duration 26:10
In welcher Vorstellung von Zeit leben wir, beziehungsweise lebten wir? Die Vorstellung von Zeit, Geschichte, Vergangenheit und Zukunft einer Gesellschaft oder einer Kultur ist eine wesentliche Frage für den Umgang mit Erkenntnis, Technologie und Politik. Dies ist historisch interessant hat aber ebenso erhebliche Auswirkungen auf die Art und Weise wie sich technischer und wirtschaftlicher Fortschritt entwickelt und unsere heutige Kultur gestaltet hat. Wie gehen wir mit unserer Zukunft um? Das hängt in starkem Maße von unserem Bild der Zeit ab.
Eine lineare Zeit mit Vergangenheit und offener Zukunft, die vor allem auch von Menschen beeinflussbar und gestaltbar ist eher eine moderne, zeitgemäße Vorstellung von Zeit, die wir nicht in allen Epochen der menschlichen Entwicklung finden. Vor der Aufklärung war etwa die europäische Kultur sehr an der Antike sowie an religiösen Mythen orientiert:
»Früher war nicht einfach nur alles besser, sehr viel früher war sogar nahezu alles perfekt.«, Achim Landwehr
Also ein Leben in der Orientierung einer vermeintlich perfekten Vergangenheit:
»Der Fortschritt musste also immer ein Rückschritt sein zu den Alten, den Antiken, den Vorfahren«, Achim Landwehr
Philip Blom schreibt, Ende 16. Jahrhundert sah man die »ruina mundi« kommen, den Untergang der Welt. Natürliche Beobachtungen wurden durch Zitate Bibel begründet, Naturkatastrophen theologisch interpretiert.
»Seit der Antike gilt: es ist egal wann sie geboren sind oder sterben, es läuft immer dasselbe Stück – Dies stimmt seit 200 Jahren nun nicht mehr.«, Peter Sloterdijk
Erst ab 1700 wird es für die Menschen erst langsam zur Möglichkeit, dass sich die Zukunft durch eigenes Handeln beeinflussen lässt. Moderne Wissenschaft beginnt sich somit in etwa ab der Neuzeit zu entwickeln und die empirischen Wissenschaften, wie Physik und Chemie beginnen langsam Form anzunehmen und nehmen ab dem 18. und 19. Jahrhundert enorm an Fahrt auf.
Heute leben wir in zahlreichen Widersprüchen, zwischen der Alternativlosigkeit politischer und wirtschaftlicher Entscheidungen, der Hilflosigkeit bei ethisch schwierigen Fragen und einem neuen Hyper-Individualismus. Welche Rolle kann der Einzelne überhaupt noch wahrnehmen?
»Tatsächlich glauben die meisten Menschen in den reichen Ländern, daß es ihren Kindern schlechter gehen wird als ihnen.« Rutger Bregman, Zygmunt Bauman
Der Philosoph Byung-Chul Han beobachtet:
»Wir leben in einer besonderen historische Phase, in der die Freiheit selbst Zwänge hervorruft. Die Freiheit des Könnens erzeugt sogar mehr Zwänge als das disziplinarische Sollen, das Gebote und Verbote ausspricht. Das Soll hat eine Grenze. Das Kann hat dagegen keine.«
Wir leben, so hat es den Anschein, zwischen Verwirrung, vermeintlichem Zwang und fragwürdigen Retropien.
Aber ist das alles überhaupt begründet? Gibt es einen Ausweg aus diesem Dilemma?
Referenzen
Zeitvorstellung- Thomas Maissen, Vom Werden der Zukunft, Spektrum der Wissenschaft, September 2010
- Achim Landwehr, Geburt der Gegenwart: Eine Geschichte der Zeit im 17. Jahrhundert
- Philip Blom, Die Welt aus den Angeln
- Zygmunt Bauman, Retrotopia
- Rushkoff, Douglas. Present Shock: When Everything Happens Now
- Peter Sloterdijk, Gespräch in den Sternstunden Philosophie
Weitere Referenzen
- Carl Becker, die Welt von Morgen
- Byung-Chul Han, Psychopolitik
- Yuval Harari, Homo Deus
- Jared Diamond: Lessons from Hunter-Gatherers
- Shoshana Zuboff, Surveillance Capitalism
- Pierre Casse, Leadership without concessions (2015)
011 - Ethik, oder: Warum wir Wissenschaft nicht den Wissenschaftern überlassen sollten!
Season 1 · Episode 11
mercredi 11 septembre 2019 • Duration 23:19
Ethik und Wissenschaft – eine überflüssige Episode?
Es gibt Wissenschafter, die sich auf die Position zurückziehen: Wissenschaft wäre nur Erkenntnisgewinn, Ethik beginnt bestenfalls mit der Anwendung. Ethik und Philosophie wären recht überflüssige Tätigkeiten, lästig und nicht hilfreich.
Ich teile diese Ansicht nicht – ich hoffe auch Sie nicht, nachdem Sie diese Episode gehört haben.
Zwei Thesen zu Beginn:
- Nassim Taleb: »Wissenschaft ist großartig, aber einzelne Wissenschafter sind gefährlich«
- Daraus folgt aus meiner Sicht: wir dürfen Wissenschaft als Gesellschaft keinesfalls den Wissenschaftern alleine überlassen sondern müssen uns energisch einbringen
Warum ist das so?
Wir beginnen mit einem kurzen Blick in die jüngere Vergangenheit bevor wir uns in die Gegenwart und Zukunft begeben. Dazu drei wesentliche Aspekte:
- Erkenntnisse die unter ethisch sehr fragwürdigen Rahmenbedingungen entstanden sind (»Nazi« Forschung, Experimente an Menschen in den 1960er und 1970er Jahren!) – wie gehen wir damit um?
- Wissenschafter mit problematischen politischen oder ethischen Ansichten (wie Martin Heidegger, Johannes Stark und Philipp Lenard, die Agitatoren einer deutschen versus »jüdischen« Physik)
- Und der Blick in Gegenwart und Zukunft: wie gehen wir mit dem enormen Potential wissenschaftlicher Möglichkeiten um, die aber ethisch umstritten sind, z.B. die Stammzellenforschung, aber auch mit ethischen Herausforderungen, die sich aus unserem kapitalistischen System ergeben. Dies betrifft etwa die Pharma-Industrie, aber auch sehr stark die Digitalisierung und Innovationen im Bereich der Informatik.
In 20 Minuten wie immer, ein erster Gedankengang, den wir später noch vertiefen können.
Referenzen
Eduard Pernkopf und der medizinische Atlas
- Gustav Spann, Untersuchungen zur Anatomischen Wissenschaft in Wien 19381945, Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes, Jahrbuch 1999
- Chris Hubbard, Eduard Pernkopf’s atlas of topographical and applied human anatomy: The continuing ethical controversy, The Anatomical Record, Volume 265, Issue 5, pages 207–211, 15 October 2001
- William E. Seidelman, Medicine and Murder in the Third Reich, Jewish Virtual Library
- Eduard Pernkopf in SA Uniform und Hitlergruß vor der Vorlesung (Dokumentationsarchiv des österr. Widerstands)
- Mary Roach, Stiff: The Curious Lives of Human Cadavers, W. W. Norton & Company (May 2004)
Tuskegee Syphillis Studie
- CDC Zusammenfassung (inkl. Entschuldigung des US Präsidenten Bill Clinton 1997)
- Christian Reinboth, Das Tuskegee-Experiment und die Grenzen medizinischer Forschung
Jüdische Physik und »Nazi-Wissenschafter«
- SEP: Martin Heidegger
- Armin Hermann, die Jahrhundertwissenschaft; Werner Heisenberg und die Geschichte der Atomphysik, rororo (1993)
- Nobel Prize: Philipp Lenard
- Nobel Prize: Johannes Stark
- beachten Sie die nur minimale Erwähnung der Thematik in der Vorstellung der Wissenschafter auf den Seiten des Nobelpreises.
Digitalisierung
- Shoshana Zuboff, Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus (2018)
- Moshe Y. Vardi, To Serve, Communications of the ACM, July 2019, Vol. 62 No. 7, Page 7
Verschiedenes