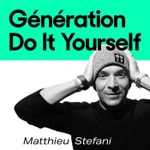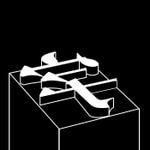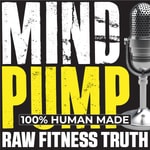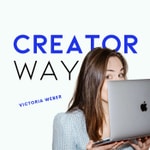Lob und Verriss - Der Podcast – Details, episodes & analysis
Podcast details
Technical and general information from the podcast's RSS feed.

Lob und Verriss - Der Podcast
Studio B und mehr
Frequency: 1 episode/9d. Total Eps: 167

Recent rankings
Latest chart positions across Apple Podcasts and Spotify rankings.
Apple Podcasts
🇩🇪 Germany - books
14/11/2024#86🇩🇪 Germany - books
13/11/2024#48
Spotify
No recent rankings available
Shared links between episodes and podcasts
Links found in episode descriptions and other podcasts that share them.
See all- https://amzn.to/4fXUf0X
2 shares
- https://amzn.to/4cEEx80
2 shares
- https://amzn.to/4dyR5iJ
2 shares
RSS feed quality and score
Technical evaluation of the podcast's RSS feed quality and structure.
See allScore global : 48%
Publication history
Monthly episode publishing history over the past years.
Studio B - Klassiker: Daniel Kehlmann "Tyll"
dimanche 8 juin 2025 • Duration 12:27
Ein Grüß aus dem Coronajahr, in dem ich teaserte:
Daniel Kehlmann schreibt uns eine subtile, vielschichtige Geschichte über Geschichte und Geschichtsschreibung, ihr Selbstbild und unsere Bild von ihr. Was beginnt, wie ein Sittengemälde des Mittelalters, jaja, Renaissance, entwickelt sich zu einem Spiegelsaal voll mit Blendern, eingebildeten Wissenschaftlern und aus der Zeit gerissenen Zeugen.
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Die Diskussion: Gneuß, Inokai, Rudiš
dimanche 1 juin 2025 • Duration 28:39
Das Kollektiv traf sich um die rezensierten Bücher der letzen Wochen nochmals genauer unter die Lupe zu nehmen als da wären:
* Charlotte Gneuß: Gittersee rezensiert von Herrn Falschgold
* Yael Inokai : Ein simpler Eingriff bespochen von Anne Findeisen
* Jaroslav Rudiš: Winterbergs letzte Reise lobpreist von Irmgard Lumpini
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Kein Abbruch!
dimanche 16 février 2025 • Duration 07:53
Die Zeiten ändern sich, manchmal schnell. Noch am 8. August 2024, also vor einem halben Jahr, warb ich hier für den Abbruch, das nicht zu Ende Lesen von Büchern, am Beispiel von dreien solcher. Zu schön war der Sommer und zu deprimierend, zu anstrengend, zu weltfremd oder einfach nur zu lang waren die Werke.
Seitdem haben wir lange vergessene Habitus (← Mehrzahl, sagt Google!) wiedererlernen müssen, das Anziehen von Anoraks zum Beispiel oder dass es erst früh um 10 hell wird, so ein bisschen und 15:00 Uhr wieder düster. Stockfinster wurde es tageszeitübergreifend dann plötzlich am 5. November 2024. Nachdem seit diesem verhängnisvollen Tag die, wie wir mittlerweile sicher sein können, faschistische Machtübernahme in den USA läuft und ähnliches hierzulande dräut, haben wir also alle das Doomscrolling wiedererlernt, man will keine Nachricht, keine Schweinetat, keine Unmenschlichkeit verpassen, um dann altklug und rechthaberisch den Kopf zu schütteln. Irgendwann jedoch schmerzt das Genick und man denkt wieder drüber nach, in Fantasiewelten zu fliehen, fühlt sich aber auch ein bisschen schuldig, im Angesicht der Diktatur des Bösen, komplett abzuschalten.
Da erinnert man sich plötzlich, da war doch jemand, damals im August, als es noch hell war, dem es damals schon so schlecht mit der Welt ging, vielleicht weiß der ja Rat. Wie hieß er noch, es war der tollste Name der Welt, genau, Shalom Auslander, dem ging es so schlecht in "Feh", dass ich mir davon nicht die Laune verderben lassen wollte und das Buch weglegte. Geschrieben hatte er es vor der Pandemie von 2020 (man sollte sich langsam angewöhnen, die Dinger zu spezifizieren), also in einer Zeit voller fun in the sun für uns - nicht so für Shalom. Fünf Jahre später lebt man selbst in dunklen Zeiten und wir alle gehören jetzt zur Zielgruppe des Buches. Also habe ich "Feh" tatsächlich zu Ende gelesen. Die Stories darin waren schon damals gut, das war nicht mein Problem und die Verzweiflung an der Welt, damals, im August noch als übertrieben empfunden, ist nun auch die meine. Woran Auslander vor allem leidet ist, dass die Menschen so unachtsam oder einfach "not nice" sind. Ja, ich sehe das jetzt auch so. Bisher war meine Meinung: "Ja, wir alle sind das mal", aber ich war sicher, alle Leserinnen von "Lob und Verriss", so als Querschnitt durch die Gesellschaft, geben sich Mühe das so selten wie möglich zu sein. Was sich seitdem verändert hat, in die Welt gekommen zu sein scheint oder einfach nur an die Oberfläche gespült wurde, ist eine systemische Brutalität. Nicht nur die übliche Gedankenlosigkeit, der Alltagsrassismus, -klassismus, -antifeminismus, whathaveyou, nein, das Pendel schwingt zurück. Brutal. Und Shalom Auslander hatte das schon im Blick, damals, prepandemisch. Also konnte er es damals schon analysieren und, na klar, nichts lässt sich auf ein Problem, ein System, ein Gift zurückführen, aber Auslander meint sich konzentrieren zu müssen auf die Hauptursacher der ganzen Kacke: die "Religion", genauer, die des Alten Testaments. Und tatsächlich, da wird aktuell zum Beispiel von einem Möchtegernintelektuellen, der sich in die luftigen Höhen des Vizepräsidialamtes der US of A hochgebumst hat, die olle Schwarte und ihre Interpretatoren zu scheinheiligen Argumentationen herangezogen, nämlich, dass es eine "Reihenfolge der Barmherzigkeit" gäbe, no s**t, das stehe schon in der Bibel. Nun, da steht alles Mögliche drin und so nimmt er halt dieses Mal das Prinzip "ordo amoris" (don't google it) und macht daraus "Ausländer raus". Der F****r. Wie kann man die Bibel so falsch lesen, fragt man sich, wenn man den Spruch gegoogelt hat (ich sagte "Don't google it"!). "Duh!", sagte Auslander, wie wir jetzt wissen, wo wir das Buch zu Ende gelesen haben, "It's a feature, not a bug". Die Bibel als Lehrbuch der Barmherzigkeit? "Geh mir weg!", argumentiert Shalom im Buch. Wo in der f*****g Bibel kommt Gott als "barmherzig" davon? Die Sintflut, bei der im Grunde nur Noah übrig blieb? Sodom und Gomorra, wo Gott direkt zwei komplette Städte ausradierte, weil, falsch gefickt? Wenn man sich diesen kleingeistigen Shithead zum Vorbild nimmt, kommt ziemlich exakt das raus, was man in den USA gerade an realer Politik sieht und was sich die CDU/CSU, als arschkriechende Nachahmer, interessiert sabbernd anschauen.
Leider ist das Buch noch nicht übersetzt, aber seine kleinen moralischen Gleichnisse und Geschichten sind in leicht verdaulichem Englisch verfasst und man erfährt nebenbei noch ein bisschen Hollywood-Gossip. Es gibt herzzerreißende Stories von seinem Freund Philip Seymour Hoffman und einen sehr geheimnisvollen Beef mit Paul Rudd. Und am Ende einen Hauch Hoffnung. Irre.
Schon lange unter dem Titel "Corvus" auf Deutsch erschienen war das zweite im August weggelegte Buch. Im Original hieß es "Fall; or, Dodge in Hell", geschrieben von Neal Stephenson und natürlich ist auch das Ding jetzt wieder ganz oben auf der Leseliste gelandet, schließlich verbraten im Buch Tech-Bros absurde Mengen an Ressourcen um für die Mehrheit der Menschen unnützen Scheiß zu machen - wo haben wir das schon mal gehört? Für den theoretischen Überbau dieser inhumanen Kacke, sprich, des sich Konzentrieren auf die Probleme einer fernen Zukunft, statt der realen Schwierigkeiten im Hier und Jetzt, habe ich letztens schon diesen Vortrag empfohlen, der mir erst bei Wiederaufnahme der Lektüre wieder einfiel, beschreibt er doch sehr verständlich die absurden aber tatsächlichen, realen Gedanken der aktuell unser aller Leben bestimmenden Multimilliardäre. In der Fiktion von Stephenson gibt es diese F****r auch, auch diese wollen eine Erde ohne Menschen, wenn auch irgendwie "positiver", vielleicht auch nur (vom Autor) unreflektierter. Aus irgendeinem Grund muss das Buch ja für Neal Stephenson Verhältnisse gefloppt sein. Aber da die real existierenden Arschlöcher, die Musks, Horowitzs, Thiels nicht genug bekommen können von Science Fiction und Fantasy und völlig ungeniert ihre Milliardenbuden nach absolut negativ konnotierten Fantasyobjekten wie z.B. Palantir, benennen, ist es fast Pflichtlektüre, die aktuellen Vorlagen mal nicht nur unter dem Unterhaltungsaspekt zu konsumieren sondern als Forschung, um zu erkennen, was in den kranken Köpfen der Superreichen aktuell so an Plänen für uns Biomasse heranreifen könnte. Also bin ich jetzt doch wieder dran am Werk und nebenbei ist Stephenson natürlich immer noch ein brillanter Schriftsteller und "Fall"/"Corvus", wenn auch viermal zu lang, super zu lesen, wenn man sich die Zeit nimmt und nicht erwartet einem gefühlt 4000-Seiten-Roman (ok, 1153 im deutschen) zu 100% folgen zu können.
Und was ist aus dem dritten Buch in der Reihe der Nicht-zu-Ende gelesenen geworden? Taffy Brodesser-Akners "Long Island Compromise"? Ja, das habe ich auch zu Ende gelesen und es hat sich als das beste der drei herausgestellt und als ein wichtiges zudem. Das war nicht wirklich abzusehen und da es am 10. März 2025 unter dem Titel "Die Fletchers von Long Island" auf deutsch erscheint, bekommt es aus diesem Anlass eine eigene Rezension. Sie wird überschrieben sein mit "Wir müssen über den Holocaust sprechen" - also wie gewohnt ein Brüller vom Herrn Falschgold.
Bis dahin, genauer bis zum 16. März 2025, verbleibt Derselbige.
P.S. Als konkrete Lebenshilfe für Winterdeprimierte empfehle ich aktuell das Hören (!) des "Zauberberg 2" von Heinz Strunk. Die Jahreszeit passt und wer nicht spontan in hysterisches Lachen ausbricht, wenn der Heinz von der Therapiegruppe im Sanatorium erzählt und schief singt:
The river she’s flowing, Flowing and growing, The river she’s flowing, Back to the sea.Mother Earth carrying me, Your child I will always be, Mother Earth carrying me, Back to the sea.
dem geht's nicht schlecht genug.
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Richard David Precht, Harald Welzer: Die vierte Gewalt
dimanche 9 octobre 2022 • Duration 23:44
Alte weiße Männer können per se nichts für ihren alten weißen Schniedel, aber wofür sie etwas können ist, wenn dieser raushängt, mitten in einer deutschen Talkshow, metaphorisch im Gesicht einer deutschen Journalistin und per Bildfernübertragung damit auch in unserem. So war das äußerst unangenehm geschehen, kürzlich, in der TV-Talkshow “Markus Lanz”. Der Schniedel gehörte Richard David Precht, den wir hier kürzlich noch als “den Perückenträger aus Solingen” milde belächelt hatten. Ein zweiter weißer Schniedel hing, das muss gerechterweise gesagt werden, nur halb raus und gehörte dem frisurtechnischen Nacheiferer Prechts, dem Soziologen Harald Welzer.
Besprochen werden sollte deren gemeinsam geschriebenes Buch “Die vierte Gewalt: Wie Mehrheitsmeinung gemacht wird – auch wenn sie keine ist”, ein wissenschaftliches Werk, wie gerade Welzer immer wieder betonte. Eingeladen zur kritischen Textanalyse waren zwei Journalistinnen, die im Buch, so wurde schnell klar, wohl selbst wissenschaftlich beleuchtet wurden, Melanie Amann vom “Spiegel” und Robin Alexander von der “Welt”.
Das Buch, nicht nur im Titel ein Frontalangriff auf den Deutschen Journalismus, kam bei den anwesenden Betreibern desselben erwartungsgemäß nicht an und da diese genug Zeit hatten, sich auf die Konfrontation vorzubereiten, sahen die Autoren beide nicht besonders gut aus, zumindest aus der Perspektive dieses unparteiischen Beobachters des Gemetzels. Zwar hatte ich kurz nach der Wende keine Zeitung unter einem Kilogramm Papiergewicht konsumiert, schon weil man in der Mittagspause, die Süddeutsche oder die FAZ auf dem Tisch konzentrierend sein partymüdes Haupt auf diese betten konnte, um ein paar Minuten leise in die Kommentarspalten sabbernd zu ruhen. Aber wann ich das letzte mal ein solches Leitmedium überhaupt in der Hand hatte, geschweige denn darin intensiv gelesen, kann ich wirklich nicht mehr sagen. Es muss ein Jahrzehnt her sein. Aber natürlich bilde ich mich politisch intellektuell, nur halt nicht, wie die Autoren Precht und Welzer das von mir erwarten. Die Einzigen, die damit umzugehen in der Lage schienen, waren die beiden leitmedialen Journalisten. Und während diese ein Argument nach dem anderen aus dem Buch auseinander nahmen und den Buchautoren um die Ohren hieben, zogen sich bei Precht die Hodensäcke in den Unterbauch zurück, die Beine wurden breiter und breiter aufgestellt und mit scharfer Stimme ergoss sich des Intellektuellen Mansplaing in’s Gesicht der Spiegel-Chefredakteurin. Diese lachte ihn aus, Harald Welzer zog sich aufs Wissenschaftliche zurück und Robin Alexander wurde spontan zum Feministen.
Die erste Amtshandlung des Rezensenten muss nun sein, sich von den verstörenden Bildern der Veranstaltung zu reinigen und das Buch als solches zu lesen und zu besprechen. Ich verspreche nichts, aber gebe mir Mühe.
Das Buch beginnt einleitend mit besagtem Frontalangriff auf die deutsche Presse, die sich vom willfährigen Berichterstatter des Regierungshandelns zum politischen Akteur emanzipiert habe. Es wird ein bisschen Verständnis gezeigt: Internet, das sog. Twitter, Kapitalismus. Es wird viel befußnotet, damit man gleich sieht, dass was man hier liest, auch wirklich Wissenschaft ist.
Wir ahnen Schlimmes, doch es folgt das erste Kapitel, das den Begriff “Öffentlichkeit” definiert und angenehm historisch, neutral, sachlich ist und damit offensichtlich geschrieben wurde, als keine aufmüpfigen Frauen im Raum waren. Oder - wahrscheinlicher - von Harald Welzer. Auch hier wird ordentlich befußnotet, wissenschaftliche Quellen wie der “Deutschlandfunk” und die Wochenzeitschrift “Die Zeit” müssen herhalten, weil Wikipedia als Fußnote unwissenschaftlich ist . Das alles, um Zitate zum US-Amerikanischen Herausgeber Hearst zu belegen, einem Kriegstreiber, wie wir lernen. Und wir ahnen, worauf der Kritiker der Waffenlieferungen an die Ukraine abzielt.
Im darauf folgenden Kapitel wird das fehlende Vertrauen des Bürgers ins “System” aufgrund Unterrepräsentanz besagten “Bürgers” im Verhältnis zum “Politiker” in den Leitmedien analysiert. Das passiert, wir hatten es schon befürchtet, anhand der Flüchtlingskrise 2015 und der Coronakrise 2020. Untersucht wird das Ganze mit “inhaltsanalytischen Studien”, also Textanalysen von Veröffentlichungen der “Leitmedien” und der Aufschlüsselung nach darin auftauchenden Themen, Personen, Gesellschaftsschichten. Was Precht und Welzer dabei versuchen herauszufinden ist, ob alle Gesellschaftsschichten in der Berichterstattung zu Wort kommen, und ob diese inhaltlich “ausgewogen” ist, also ob alle öffentlichen Meinungen repräsentiert sind.
Problematisch dabei: Studien von Extremsituationen als Grundlage zur Beweisführung von Thesen zu verwenden ist generell schwierig und speziell in diesem Fall fragwürdig, denn bei den Fragen, die diese beiden “Krisen” aufgeworfen haben, gibt es nun mal anerkannte moralisch-ethische Grundhaltungen in unserem Land, die eben nicht fifty/fifty "Kieken wa ma, was det Volk so denkt!” zu beantworten sind, sondern im Rahmen der Bundesdeutschen Grundordnung schon eindeutig beantwortet sind: “Flüchtlinge aufnehmen Ja!”, sagt das Asylrecht, “Impfen Ja!”, sagt das Infektionsschutzgesetz. Was zu den Themen in den Leitmedien stand, war also recht erwartbar.
Die Haupterkentnis aus den Textanalysen (hier beispielhaft zur Flüchtlingskrise) ist, so das Buch, dass hauptsächlich Politiker zu Wort kamen (zu bis zu 80%), nicht jedoch die Helferinnen oder gar die Betroffenen, also die Flüchtenden. Das klingt dramatisch, ein wirklich kurzes Überlegen kann einen aber darauf bringen, dass in einer unübersichtlichen Situation, einer Krise eben, in der vornehmlich um Ordnung gerungen wird, diejenigen zu Wort kommen, deren Job das praktische Errichten von Ordnung ist. Politiker zum Beispiel. Stattdessen wird beklagt, dass die lokalen Helfer in der Berichterstattung unterrepräsentiert wären und passend zum Ton des ganzen Buches werden gleich mal Parallelen gezogen zu obrigkeitshöriger Wilhelminischer Berichterstattung, no s**t. Das Problem ist doch aber: Wie löst man eine nationale Krise? Diese den “Nothelfern” überzuhelfen ist eine Option, aber sinnführender ist es, in einem solchen Fall nationale (und noch besser europäische) Lösungen zu etablieren. Und darüber wurde berichtet. Verrückt.
Hier geht also mit den Autoren der Wunsch nach Sensationalismus durch, sie wählen exakt die nicht repräsentativen Beispiele zur Untersuchung aus und schießen sich damit selbst ins Bein. Wie viel interessanter wäre es, ein medial weniger präsentes Thema zur Textanalyse zu wählen, idealerweise eines, welches nicht in statistisch kaum verwertbaren, minimalen Zeiträumen aufflammt und wieder erlischt. Ich bin sicher, die aufmerksame Leserin unserer gesammelten Rezensionen kommt auf ein paar Ideen.
Und am Ende des Abschnitts zur Inhaltsanalyse “Flüchtlingskrise” merken das die Autoren sogar, Zitat: “Aber könnte es nicht sein, dass die leitmediale Berichterstattung der Presse zur sogenannten Migrationskrise diesbezüglich ein Ausnahmefall war?”. So close. Sie setzen fort: “Schauen wir deshalb auf andere Krisenereignisse und ihre mediale Bearbeitung."
Es folgt also die gleiche Übung zur Coronakrise ohne jeglichen Erkenntnisgewinn: Politiker stehen während einer Krise im Mittelpunkt der medialen Berichterstattung. Wer sonst, fragt man sich.
Und weil man auf durchschossenen zwei Knien immer noch irgendwie ins Ziel robben kann, folgt die exakt gleiche Argumentation zur nächsten Krise, der aktuellen, jetzt gleich ganz ohne wissenschaftliche Untersuchungen, weil, ist ja noch im Gange: der Ukrainekrieg. Es lohnt kaum, die gleichen Argumente nochmals zu besprechen, zumal sie diesmal nicht analytisch unterlegt sind. Dass dieses Fehlen einer Analyse das Thema für ein nach wissenschaftlichen Methoden erstelltes Buch ausschließen sollte, ignorieren die beiden Wissenschaftler und so müssen wir ein dutzend Seiten Meinung über uns ergehen lassen, die, wie es Meinungen so an sich haben, teilweise Übereinstimmung erzeugen, hier z. B.: das Fehlen der Berichterstattung in deutschen Medien zur Haltung zum Krieg aus anderen Teilen der Welt. Viele der Meinungen führen jedoch zu entschiedener Ablehnung aufgrund von: Blick auf die f*****g Landkarte.
Das nächste Kapitel “The Unmarked Space” greift die Erkenntnisse aus dem vorigen auf und will laut Untertitel extrapolieren, “was Leitmedien nicht thematisieren” und man ist, leicht erschöpft, geneigt hier zum Rotstift zu greifen wie der alte gestrenge Mathelehrer und den Rest des Buches ungelesen wie einen misslungenen mathematischen Beweis durchzustreichen und mit einer 5 zu benoten. Denn wer im ersten Schritt der Beweisführung einen solchen entscheidenden Fehler begeht, wie die beiden Autoren, namentlich Textanalysen nicht repräsentativer Ereignisse für den allgemeinen Erkenntnisgewinn heranzuziehen, begeht etwas, was man in der Philosophie Fallazien nennt, aber da man selbst aus denen noch etwas lernen kann und wir 20 EUR überwiesen haben, nehmen wir die Herausforderung an, das Ding zu Ende zu lesen. Es wird zum Beispiel spannend sein zu sehen, ob der “Fehler” im ersten Schritt nur gemacht wurde um die Thesen wirksamer an den Leser zu verkaufen, die Thesen also trotzdem und im Grunde so vertretbar sind und nur sensationsheischend eingeführt wurden, oder ob die Autoren tatsächlich ihre Integrität als Wissenschaftler aufs Spiel setzen und uns einen großen Wissenschaftsblabla überhelfen, nur um publikumswirksam ihre jeweiligen Lieblingssäue durchs Internet zu ranten, Waffenlieferungen an die Ukraine im Fall Welzer und dass ihn keiner ernst nimmt, den Richard David Precht. Und zugegeben ist das Buch, wenn immer es von Welzer im Erklär- und nicht im Argumentationsmodus (und von Precht gar nicht) geschrieben wird, lesbar und milde interessant.
Wohlan, was also wird von unseren Leitmedien nicht thematisiert? Tipps werden angenommen.
Zunächst setzt sich ein Pattern fort. In den Einleitungen, hier, “was bedeutet Realität in der Medienlandschaft?”, wimmelt es von Fußnoten, die Eindruck machen, in den anschließenden Behauptungen, die die Grundlage für den Beweis der eigenen Thesen legen sollen, fehlen sie plötzlich. Da wird mal eben in einem Nebensatz die Behauptung aufgestellt, dass Informationen, die nur mit großer Mühe, Aufwand und sorgfältiger Recherche zu erlangen sind, immer seltener würden, eine Behauptung, die nach einer Fußnote mit Belegen dafür schreit, aber ohne diese auskommen muss. Vielleicht liegt es daran, dass erkennbar am anprangernden Schreibstil (“erschreckend”, “Vereinseitigung der Perspektive”, “vorauseilender Gehorsam”) der Solinger Intellektuelle P. die Klinge schwingt und sich erwartbar selbst mutiliert. Der Zweck dieser Operation am eigenen Hirn ist ein rant mit dem Tenor, dass Journalisten lieber Feuilleton-Pingpong mit sich selbst spielen denn zu Recherchieren, lieber mit Eliten kuscheln statt sich dem unsichtbaren Teil der Bevölkerung, den Unterschichten und Derlei, zu widmen.
Dabei kommen die Autoren mittelbar zum Thema der engen Vernetzung zwischen Politik und Journalismus und haben dort an sich die richtige Fakten bei der Hand und zitieren auch daraus, hier eine Studie aus 2014, die damals über den Umweg der Satiresendung “Die Anstalt” die Runde machte und die Vernetzung von NATO-nahen Stiftungen und Journalisten wie Joffe und Bittner von der “Zeit” aufdeckten. Wie sich herausstellt, hatte aber Harald Welzer mittlerweile das Worddokument geblockt und kommt, nicht ohne vorherige Absicherung, dass hier keinesfalls ein Lügenpressevorwurf erhoben werden soll (besser ist das) zum erwartbaren Punkt: Waffenlieferungen an die Ukraine.
Dass sich die beiden Autoren ausgerechnet den Ukrainekrieg als Beispiel für verengte Pluralisierung in den Medien vornehmen, ist tragisch. Sie gehen damit in die gleichen Fallen, die sie den kritisierten Medien vorwerfen. In Welzers Fall, als Unterzeichner des “Emmabriefes” gegen die Waffenlieferungen in die Ukraine, nimmt er ein Thema, in welchem er selbst die Öffentlichkeit manipulieren möchte als Beispiel dafür, dass die Medien die Öffentlichkeit manipulieren. Und die Rampensau Precht sagt natürlich “let’s go for it” denn er weiß, wann ihr Buch rauskommt und ist sich sicher, dass zu diesem Zeitpunkt der Krieg noch das Thema No 1 sein wird und damit Medienpräsenz garantiert ist. Das ist tragisch, denn die Vorwürfe der Verengung der medialen Informationsvermittlung sind es wert, dass man ihnen auf den Grund geht, aber, mal abgesehen vom Holocaust, ist jedes Thema geeigneter, das zu diskutieren als ein Krieg, in dem Angreifer und Verteidiger auf einer f*****g Landkarte zu erkennen sind.
Das Ende des Kapitels deutet an, welches Mitglied des Autorenduos gleich den Textprozessor beackern darf: mit bestechender Logik schreibt Precht: “Wer in der Politik nicht vorkommt, kommt auch in den Medien nicht vor. Und umgekehrt.” Das stimmt, a) immer, b) wenn doch nicht, dann doch, indem man “zwangsläufig” davor schreibt und c) “Zur Sicherheit machen wir das jetzt kursiv!”.
Es geht also um “Gala-Publizistik”, wie das Kapitel überschrieben ist und jetzt geht’s zur Sache, denn “Politischer Journalismus sei Journalismus über Politiker, weniger über Politik”. Es riecht nach Futterneid und Brusttrommellei und es wird im ersten Absatz klar, wer der andere Gorilla sein soll: Robin Alexander, Chefredakteur der Welt: jemand der so prototypisch wie ein CDU-Wähler aussieht, dass ihm CDU-Politiker wohl immer alles erzählen müssen und der das dann also weitererzählt. Doch wir werden überrascht. Nicht Precht hat beef, der bisher so fundiert schreibende Welzer nimmt sich das Mitglied des FC Schalke 04 Fanclub “Königsblau Berlin” zur Brust, und zwar anhand einer Story, in der Robin Alexander Informationen aus einer CDU/CSU-Fraktionssitzung zuerst auf Twitter veröffentlichte, statt am nächsten Tag in der “Welt”. Das sei ein Skandal, unjournalistisch und ein Beispiel für das Grundübel, weil man in Realtime in die Fraktionssitzung zurück funke, statt hinterher darüber zu berichten und damit Politik beeinflusse. Man dankt als Leser Harald Welzer leise dafür, dass es nicht darum ging, dass er den Alexander nicht leiden kann (ok, wissen wir nicht) sondern, dass er Twitter nicht leiden kann. Das wissen wir genau, weil Harald Welzer kein Twitterprofil hat. Vielleicht hat er Twitter auch einfach nicht verstanden.
Precht übernimmt schnell wieder, schließlich hat er sich die Überschrift des Kapitels ausgedacht. Es folgen freie Assoziationsketten in bildreicher Sprache zum Thema Medien und Politik, die komplett frei von Begründung und komplett zustimmungsfähig sind: Politik wird unipolarer, Politiker unschärfer, Medien lauter. Das ganze unterlegt mit altbekannten (und richtigen) Beispielen aus der Zeit der neunziger und nuller Jahre, wie die Rot-Grünen das gemacht haben, was auch die Schwarz-Gelben gemacht hätten: Kampfeinsätze in Jugoslawien, Dosenpfand und Hartz IV. Kanzlerduelle seien US-Cosplay, polarisierte Wahlkämpfe bringen Einschaltquoten und die bringen Geld, wobei auch hier wieder die Fußnoten mit den Belegen fehlen, angesichts des Autors wohl aus Faulheit, denn wegen fehlender Zahlen, die aber in Deutschland vielleicht nicht ganz so aussagekräftig wären, wie die in den USA, was z.B. die Profite von Spiegel oder RTL in Wahlkampfjahren vs. dazwischen betrifft. Aber es wäre interessant gewesen, das zu vergleichen. Nichts von dem tut weh, nichts von dem macht uns schlauer, aber Precht liest gerne Precht und da müssen wir jetzt alle durch. Was schade ist, weil sich aus diesen Plattitüden und bekannten Weisheiten etwas entwickeln lässt. Dazu muss man natürlich seine Metaphernsucht im Griff haben und vielleicht nicht nur Beispiele aufzählen, die wir alle auch so im TV sehen und die uns alle genauso aufregen, wie z.B. das aufs Wort vorhersagbare Frage- und Antwortspiel zwischen Journalisten und Parteivorsitzenden an Wahlabenden. Da sollte schon mehr kommen, also besser zurück zu Welzer.
Aber: F**k! S**t! Der hatte 2012 im Fernsehen den TV-Psychologen gegeben und war damals mit einer psychologischen Fernanalyse des amtierenden Bundespräsidenten Christian Wulff zum Medienschaffenden geworden. Autsch. Das muss natürlich proaktiv erwähnt werden, und zwar mit dem wirklich grandiosen humblebrag, dass man nicht wissen könne, ob Welzer damals zum Rücktritt des Bundespräsidenten beigetragen habe. Man sagt “mea culpa” und macht das Beste draus: man bestätigt seine Tätigkeit als Jäger im Fall Wulff und beschreibt, wie man sich so fühlt als Teil der Meute (Zugehörigkeit, Anerkennung, Komplizenschaft) und haut uns damit allen auf den Kopf. Uns allen heißt in dem Fall: uns allen in der “Wahlverwandtschaft” bei Twitter, wenn es uns auf dem Socialmedia-Dienst nicht um Aufklärung oder gar Wahrung des Gemeinwesens vor Schaden gehe (what?), sondern darum, jemanden zur Strecke zu bringen und dafür Beifall zu bekommen. So schreibt das der R.D.P. Oder der H.W. Ja, HW und RDP, so nennen sich die Bros im Buch. Yo.
Zum Glück sind wir in der Twitterfamilie gleich wieder aus der Schusslinie, R.D.P., also der Richard, hält wieder auf seine eigentlichen Feinde, es fallen Worte wie “Enthemmung”, “Moralverlust”, “Anstandsniveau”, “Verunglimpfung” und “Treibjagd”. Das alles explizit auf den deutschen politischen Journalismus bezogen. Unter solchen Substantiven macht es der Precht nicht und wir hoffen im nächsten Kapitel auf Antworten, warum das so ist. Der Titel lässt nichts Gutes hoffen. Er lautet:
Cursorjournalismus
Nicht nur das schwache Kunstwort, auch die ersten Sätze im Kapitel lassen uns wissen, wer jetzt schreibt. Denn es geht um: Waffenlieferungen an die Ukraine. Ok, die Marke ist gesetzt und Harald Welzer gibt uns also einen Abriss über den Unterschied zwischen unrealistischen Verschwörungstheorien (Lügenpresse, Coronaleugner) und der tatsächlichen und durchaus belegbaren Regierungsnähe von Journalisten. Das ist der Stuff, wegen dem wir hier sind. Welzer belegt und beschreibt, ordnet ein und ist auf dem besten Wege uns Erkenntnisgewinn, wenn nicht Lösungen zu präsentieren, und muss doch immer wieder auf den Ukrainekrieg zurückkommen, als hätte er einen alten Aufsatz zum Thema zweitverwertet und mit seinem aktuellen beef befüllt. Das ist, wie schon einige Male im Buch, schade, denn natürlich hat Welzer was zu sagen zum Thema und wäre er nicht so abgelenkt, würde er es tun, wir sind sicher. Und tatsächlich, nach und nach bekommen wir interessante Abrisse aus der bundesdeutschen Geschichte, als man noch wusste, wer journalistisch rechts und wer links stand, kongruent zur Polarisierung der politischen Lager. Seit dem Mauerfall ist nichts mehr links oder rechts und alles strebe zur Mitte und das führe dazu, dass die Medien wichtiger würden. Ok. Warum genau? Welzer wird konkreter und führt, man möchte fast sagen “plötzlich” eine stimmige, bedenkenswerte und gut erklärte Theorie der Medien in einer Zeit hoher Komplexität und geringer Aufmerksamkeitsspanne ein. Ziemlich genau zur Hälfte des Buches sagt mein Kindle. Ich komme mir vor wie ein Bergarbeiter, den Abraum hinter sich, die Silberader im Blick. Leider greift Kumpel Precht zur Hacke und meint, statt uns Welzers gut gefügten Ansichten zu überlassen, brauchen wir jetzt schnelle und rassig formulierte Schlussfolgerungen und begründet mit diesen (mal wieder) seine persönlichen Ansichten, die aktuellen Leitmedien wären eine Meute von Bluthündinnen. Es folgen Absätze mit den folgenden Worten, die immer aktuelle TV- und Pressepublikationen beschreiben: “Jagdfieber”, “Marschtakt”, “über jemanden herfallen”, “Verunglimpfen”, “hysterische Ausgrenzung”. Die Pressemeute erzeuge so ein “Wir”, werde also zur homogenen Massen und Welzer übernimmt gerne die Vorlage und verdächtigt diese der unisono Kriegstreiberei durch das Befürworten von: Waffenlieferungen in die Ukraine. Es ist ein bisschen traurig.
Was Cursorjournalismus eigentlich ist? Es ist zu bescheuert. Und auch irrelevant. Es lohnt kaum die folgenden Kapitel einzeln durchzugehen, auch wenn das verdächtig Precht-faul klingt. Das Pattern ist immer das gleiche: Welzer doziert und befußnotet sozialpsychologisch mäßig interessant auf eine Schlussfolgerung hin, die immer in etwa darauf hinausläuft, dass Journalisten einfach nicht mehr das sind, was sie einmal waren. Dann übernimmt Precht und denkt sich ein paar scharfe Adjektive und Metaphern aus, um die Schlussfolgerung für den beschränkter vermuteten Teil der Leserschaft nach Hause zu prügeln. Der klopft sich vermutet auf die Schenkel und wirft Facebook an um die saftigen Formulierungen dort reinzuposten, damit Reichweite werde.
“Der Journaille haben wir’s gezeigt!” denkt Precht privat und formuliert für die Öffentlichkeit seriös um.
“Worauf habe ich mich bloß eingelassen” denkt Welzer, und versteckt sich öffentlich hinter seiner Wissenschaftlerkarriere und hofft, dass Putin bald den Löffel abgibt und die Öffentlichkeit seine peinlichen intellektuellen Entgleisungen zum Thema vergisst.
Was vom Anfang bis ans Ende des Buches immer und immer wieder erstaunt, ist, wie unreflektiert man sein kann und man fragt sich: ist das, weil oder trotzdem die Autoren sich permanent in die Öffentlichkeit begeben? Sie schreiben: Man wisse ja, dass es unseriös sei, Sätze aus dem Zusammenhang zu reißen, wie das auf diesem Twitter ständig passiere und finden dann ihre Argumente in Reden von Springer-Chef Mathias Döpfner. Man beharrt auf Recherche und dem Schreiben über Dinge, von denen man etwas verstehe und stellt sich dann, wie so ein pickeliger Abiturient in der Berufsberatung, vor, wie Redaktionskonferenzen in großen Tageszeitungen ablaufen, statt mal zu recherchieren, was dort wirklich passiert. Es wird von der ersten Seite an die “Personalisierung der Debatte” angeprangert und man prangert permanent konkret Journalisten an. Es wird erklärt, dass die Journalisten - alle - eine Meute bilden, die sich im groupthink gegenseitig vergewissern und man vergewissert sich permanent in gegenseitiger Zustimmung, das man Recht habe, auch wenn das gar nicht sein kann, weil der eine Autor intellektuell faul und der andere ein anerkannter Wissenschaftler ist.
Die Frage bleibt: musste man sich wegen dieses Buches so entblößt in eine Talkshow setzen und ich denke, wir haben sie beantworten können.
Denn, wer aus Eitelkeit oder Sendungsbewusstsein behauptet, ein wissenschaftliches Werk zu veröffentlichen, welches bei näherer Betrachtung nur ein Vorwand ist, die zwei, drei talking points, die einen gerade beschäftigen, medienwirksam unter die Leute zu bringen und sich als Thema dieses "wissenschaftlichen Werkes” ausgerechnet den Medienbetrieb raussucht um dann zu 100% folgerichtig von den routinierten Samurais ebendieses Medienbetriebes zu Hasché verarbeitet zu werden, hat an sich nur zwei Betriebsmodi, mit denen er in eine wahrscheinlich lange zugesagte Promotalkshow wie die bei Lanz gehen kann. Man kann, wie Welzer, den gelassenen Wissenschaftler geben und milde lächelnd alle anderen für dumm erklären oder, weil man halt keiner ist, wie Precht, die Beine breit machen und mansplained dann den s**t aus dem eigenen Unsinn, worauf man beleidigt ist, wenn alle über einen lachen.
Schade ist das vor allem, weil, selbst wenn man das Alter der Autoren hat, und offenbar nicht anders kann, als den deutschen Journalismus auf die Leitmedien zu verengen, es an diesem einiges zu analysieren gibt. Sein Aufstieg und Fall ist faszinierend und wenn man wirklich nicht mit neuen Medien kann, und hier sind nicht nur die “Direktmedien” gemeint, wie Welzer begriffsschafft, was wir Nichtelitären “social media” nennen, hat man locker ein gutes Buch drauf, wenn man wie Precht in diesen Leitmedien lebt und wie Welzer was Richtiges studiert hat. Aber nein, man weiß tief drin, dass es ein ernsthaftes Werk über ein begrenztes Thema fürs eigene Ego nicht mehr bringt, man will Aufmerksamkeit, tappt in die Projektionsfalle und postuliert: Alles Egozentriker außer ich, ich, ich!
Und so sei abschließend die Frage erörtert, die jeder Rezension als Grundlage dienen sollte: für wen ist dieses Buch? Wer könnte sich dafür interessieren, wer wird Genuss beim Lesen empfinden, wer wird sagen “Toll argumentiert!", “Toll formuliert!”?
Nun. Mir fallen eigentlich nur zwei Leserinnengruppen ein: die Fans von Richard David Precht und die Fans von Harald Welzer. Und seit dem schniedelschwingenden Auftritt der beiden Autoren in besagter ZDF TV-Show werden sich diese Gruppen wohl entleert haben, bis nur noch jeweils ein Mitglied übrig war und bei Harald Welzer bin ich mir da nicht so sicher.
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Die Diskussion: Jeanine Cummins - American Dirt
dimanche 2 octobre 2022 • Duration 42:57
Da die drei Rezensentinnen drei recht unterschiedliche Ansichten zum gleichen Roman hatten, waren am Ende alle glücklich darüber, dass sie sich wenigstens in Sachen “Kulturelle Aneignung” einig waren! Haha. Es ging zur Sache und nicht nur über einen Roman, der nicht auch unsere kleine Literaturabteilung spaltet. Ob wir dennoch eine gemeinsame Leseempfehlung abgeben, erfahrt ihr am Ende.
Ok, wir sind hier nicht bei der Sportschau:
* Irmgard: Nein
* Anne: Ja
* Falschgold: Kommt drauf an
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Jeanine Cummins - American Dirt
dimanche 18 septembre 2022 • Duration 09:37
Der Sommer neigt sich schon langsam wieder dem Ende zu und das Studio B Kollektiv ist aus dem Urlaub zurück, den ich für meinen Teil dazu genutzt habe, endlich eine lang geplante Reise zu unternehmen. Das Ziel: die Vereinigten Staaten von Amerika. Vor nunmehr fast drei Jahren entschlossen sich zwei mir sehr lieb gewonnene Menschen, Deutschland den Rücken zu kehren und ihr Leben in den USA fortzusetzen. Damit stand für mich schnell fest, dass ich sie eines Tages dort besuchen würde und so begann ich – mit den ersten fünf Dollar, die ich als Trinkgeld bekam – meine Spardose allmählich zu füllen, um mir diesen Traum zu verwirklichen. Schon längst hätte ich bzw. hätten wir diese Reise angetreten, wenn nicht äußere Umstände dies immer wieder verzögert hätten. Doch Anfang August war es endlich soweit und die Frage nach der Urlaubslektüre war ebenfalls so gesetzt wie das Reiseziel. Heiko Schramm, auch bekannt als Hesh, geschätzter Freund und ehemaliges Studio B Mitglied empfahl nicht nur mir, sondern auch Irmgard Lumpini und Herrn Falschgold, einen Roman der Autorin Jeanine Cummins und ich dachte mir, was könnte passender sein, als nach Amerika zu reisen und ein Buch mit dem Titel American Dirt zu lesen.
Im Jahr 2020 erschien Jeanine Cummins Roman American Dirt sowohl im englischen Original als auch in deutscher Übersetzung im Rowohlt Taschenbuch Verlag. Während ich in den Flieger steige und es mir bequem mache, mir noch einen Schal und eine Strickjacke aus dem Handgepäck zurecht lege, damit ich während des Fluges nicht friere und dem Beginn einer komfortablen Reise entgegenblicke, beginnt für die Protagonisten in Cummins' Roman ein Albtraum, der ihr Leben komplett verändern und sie ebenfalls auf eine Art Reise schicken wird, die sich grundlegend von der meinigen unterscheidet, bis auf die Tatsache, dass unser Ziel das Selbe ist: Amerika.
Die Reise der Protagonisten Lydia und ihres 8-jährigen Sohnes Luca beginnt in Acapulco, Mexiko. Unvermittelt befinden sich Cummins' Leserinnen und Leser in einem Kugelhagel, ausgelöst durch ein mexikanisches Kartell, dass während eines Grillnachmittags innerhalb kürzester Zeit Lydias und Lucas Familie auslöscht, genauer gesagt 16 Angehörige, darunter auch Lydias Mann Sebastián und ihre Mutter, während sie es schafft, sich und Luca im Bad vor den Killern zu verstecken und somit ihr Leben zu retten. Nachdem sich die Mörder zurückgezogen haben und das ganze Ausmaß des Schreckens deutlich wird, wird Lydia aber auch schnell bewusst, dass ihr Sohn und sie fliehen müssen, da sie von der Polizei – die ohnehin korrupt ist – keine Hilfe zu erwarten haben und das Kartell so lange nach ihnen suchen wird, bis sie auch sie getötet haben. Während Lydia ihre Flucht organisiert, weiß sie nicht, wie knapp sie dem Kartell entgeht, bevor sie sich mit ihrem Sohn Luca auf den Weg nach el norte macht, wie der Norden im Roman genannt wird.
Wir sind inzwischen im Bundesstaat Washington angekommen, der als Evergreen State seinem Namen alle Ehre macht und mit seinem vielen Grün, den Wäldern, den Bergen, aber auch dem Meer ideal ist, um viel Zeit in der Natur zu verbringen. Auch der kleine Ort, in dem meine Freunde leben, hat es mir angetan und könnte mit seiner Beschaulichkeit und seinen kleinen Häuschen glatt einer amerikanischen Serie entsprungen sein.
Auch Lydias Leben ist einmal beschaulich gewesen. Sie führte einen kleinen Buchladen in Acapulco durch den sie auch Javier Crespo Fuentes kennenlernt, mit dem sie sich anfreundet und von dem sie zunächst nicht weiß, dass er der Chef des Los Jardineros Kartells ist. Er ist kultiviert und über seine regelmäßigen Besuche, gemeinsame literarische Vorlieben und Gespräche, entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden. Problem ist nur, dass Lydias Mann Sebastián Journalist ist, dessen Steckenpferd es ist, über Kartelle zu berichten und der eine große Story über Javier und Los Jardineros zu veröffentlichen plant. Was er schließlich auch tut und damit eine Reihe von Ereignissen in Gang setzt, die letztlich dazu führen, dass er selbst tot in seinem Garten liegt und seine Frau und sein Sohn auf der Flucht sind.
Im weiteren Verlauf des Romans wird Lydias und Lucas beschwerliche Reise beschrieben, deren Ziel es ist, dem langen Arm des Kartells zu entkommen und sich gezwungenermaßen in den Strom anderer Flüchtlinge einzureihen. Dabei lernen sie die beiden Schwestern Rebeca und Soledad aus Honduras kennen, die ihnen auch dabei helfen, die Fahrten auf dem berüchtigten Todeszug La Bestia – langen Güterzügen, die das Land durchqueren – zu überstehen. Denn sie sind die einzige Möglichkeit, den langen Weg von Mexiko in die USA nicht zu Fuß bestreiten zu müssen. Doch das Aufspringen auf die Züge ist gefährlich und auf ihnen tummeln sich meist schon viele Migranten. Daher versuchen sie stets so unauffällig wie möglich zu bleiben, denn jeder Mitreisende könnte ein Gesandter des Kartells sein, der nach ihrem Leben trachtet. Und auch die spontanen Einsätze der Polizei sind ein Faktor, der die Flucht jederzeit in Gefahr bringen und scheitern lassen kann.
Wir sind mittlerweile in San Diego angekommen und Dank eines Mietwagens können wir nicht nur problemlos die Stadt und das dazugehörige Umland, wie die wunderschöne Coronado-Halbinsel erkunden, sondern finden auch einen höher gelegenen und beliebten Aussichtspunkt rund um einen alten Leuchtturm, von dem aus man bei guter Sicht bis nach Mexiko blicken kann. An diesem Tag herrscht leichter Nebel, doch ich blicke in die Richtung, in der Mexiko liegt und denke unwillkürlich an das von mir gelesene American Dirt und bin mir dessen bewusst, dass ich mich gerade an einem Ort befinde, der das Ziel von vielen ist.
Während des Lesens wird man immer wieder Zeuge unfassbarer Gewalt und Grausamkeiten die den Migranten, die meist ohnehin schon traumatisiert sind, angetan werden und die alles über sich ergehen lassen, wenn sie nur überleben und damit ihrem Ziel – ein besseres Leben zu führen – etwas näher kommen. Wir lesen aber auch von Momenten der Nächstenliebe durch beispielsweise Außenstehende, die den Migranten Wasser und Essen zur Verfügung stellen und der gegenseitigen Hilfe der Migranten untereinander, ohne die es vermutlich ein aussichtsloses Unterfangen wäre.
Schließlich führt der unbändige Wunsch, dass alles bisher Geschehene nicht sinnlos war, das Gefühl seinem Ziel näher und näher zu kommen und die Hoffnung auf ein Leben in Sicherheit und ohne Angst, einen Teil der Menschen, deren Geschichte Jeanine Cummins erzählt, auf die letzte Etappe einer beschwerlichen Reise. Es ist der Weg durch die Wüste, den die Migranten mittels eines Cojoten zurücklegen und der sie all ihre Ersparnisse und Kraft kostet.
Während wir selbst, auf unserem Weg von San Diego zum Grand Canyon, in einer 9-stündigen Autofahrt die Wüste und ständig wechselnde Landschaften durchqueren, muss ich oft an American Dirt denken. Ich hoffe die ganze Zeit, dass wir mit dem Mietwagen nicht mitten im Nirgendwo liegen bleiben – obwohl die Landschaften beeindruckend sind – und gleichfalls hoffe ich, dass die Klimaanlage nicht ausfällt, denn die Außentemperaturen liegen wahrscheinlich bei 45 Grad. Ich frage mich, wie es Menschen möglich ist, solch höllische Torturen auf sich zu nehmen. Frage mich, wie groß deren Leidensdruck oder deren Angst ist und wie es der menschliche Körper schaffen kann, solche Strapazen zu überstehen, was ebenfalls bedeuten muss, dass es Menschen möglich ist, ein unbändiges Maß an Hoffnung zu empfinden, das sie weitergehen lässt.
Auch wenn Jeanine Cummins Roman eine fiktive Geschichte ist, ist es doch sehr real, dass täglich Menschen aus verschiedenen Ländern flüchten, dass sie Unglaubliches auf sich nehmen und viele von ihnen dabei sterben oder einfach spurlos verschwinden. Wie sie selbst in ihrem Nachwort erwähnt, gibt es dazu kaum belastbare Statistiken. Was Cummins' mit ihrem Roman für mich schafft ist, dass sie mich als Leserin unvermittelt in ihre Geschichte zieht, deren Tempo äußerst rasant ist und einem genauso wenig Zeit gibt zu überlegen, wie der Protagonistin selbst, die einfach nur handelt, um das Leben ihres Sohnes und ihr eigenes zu retten. Bis dato hatte Lydia kein schlechtes Leben geführt, im Gegenteil, und nun zeigt uns Cummins, auch anhand der vielen anderen Figuren in ihrem Roman, wie unterschiedlich die Beweggründe sein können, dass Menschen sich solcher Gefahren aussetzen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben. Damit nehmen wir sie nicht nur als gesichtslose Masse von Migranten wahr, sondern bekommen die Möglichkeit, unsere eigenen Ressentiments zu erkennen, zu überdenken und in ihnen die Individuen zu sehen, die sie sind. In meinem Fall ist Jeanine Cummins das sehr wohl gelungen und für mich besticht ihr Roman neben allem Schrecken auch durch sein Mitgefühl und den Wunsch, den Menschen gerecht zu werden und stellvertretend für die zu stehen, die ihre Geschichte nicht selbst erzählen können. Eine Reise geht zu Ende. Für mich war es eine wunderbare Reise, auf der ich so viel Schönes erleben und entdecken konnte, auch deshalb, weil ich den richtigen Pass und das nötige Kleingeld hatte. Auf der mir aber auch die Schattenseiten des Landes, der unbegrenzten Möglichkeiten nicht entgangen sind. Für Lydia und Luca endet eine Tortur, aber zumindest lässt uns Jeanine Cummins hoffen, dass sie nun ein friedlicheres Leben führen können.
In der nächsten Woche erfahren wir, wie es Irmgard Lumpini mit der Lektüre von American Dirt ergangen ist.
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Jeanine Cummins: American Dirt
dimanche 11 septembre 2022 • Duration 13:54
Das erste Kapitel von “American Dirt” ist sicher eines der härtesten, die man seit langem hat lesen müssen. Aus der Sicht des achtjährigen Luca erleben wir, wie dessen achtzehnköpfige Familie bei einem Massaker durch ein mexikanisches Drogenkartell auf ihn und dessen Mutter Lydia dezimiert wird. Psychologisch effektvoll erleben wir das Ganze nur durch sekundäre Beobachtungen des jungen Luca - Geräusche, Gerüche, Geschrei - der zufällig im Augenblick des Überfalls im ersten Stock des Hauses pinkeln ist, während im Garten das Mordkommando arbeitet. Kurze Zeit später kommt seine Mutter Lydia ins Bad gestürzt und zusammen erleben sie die Katastrophe, versteckt hinter einem Duschvorhang.
“Moment!”, ruft da Heiko Schramm, Freund der Show und ehemaliger Rezensent ebenda, dem Ihr im Übrigen diese und die zwei weiteren Rezensionen ein- und desselben Werkes anregungsweise zu verdanken habt. “Im Prolog von Don Winslows ’Tage der Toten’ bringt ein Kartell aber eine neunzehnköpfige Familie um! Einer mehr!”
“Das ist wohl wahr.”, antworten wir, aber es gibt einen Unterschied. Zu dem kommen wir gleich, handeln wir jedoch zunächst kurz ab, was sonst noch in “American Dirt” passiert: Das Buch ist lang, doch die Handlung ist simpel und linear; in einem Satz zusammengefasst: Mutter und Sohn, Lydia und Luca, als einzige Überlebende der Familie Perez offensichtlich im Fadenkreuz der Killer des Kartells “Los Jardineros”, fliehen in die USA. Das war’s. Die Handlung wird entweder aus der Sicht Lydias oder Lucas beschrieben, sie verzweigt niemals, und ausser ein paar Rückblenden auf das Leben der Familie vor dem Massaker geht es straight von Acapulco im Süden Mexikos nach “El Norte”, nach Norden, nach Arizona, United States of America.
Kein Stück Kritik von mir dazu, dieser Rezensent braucht keine Vorblicke, Rückblicke oder Handlungsstränge, die sich irgendwo treffen und wieder verlieren, wenn jemand gut schreibt und einen Plan hat, worüber er schreibt und das in die Tat umsetzt, hat sie in meinem Kassenbuch der Literaturkritik einen ausgeglichenen Kontostand, Soll und Haben in neutralem schwarz, Doppelstrich drunter und abheften.
Jeanine Cummins, die Autorin, die mit “American Dirt” ihr viertes Buch vorlegt, schreibt gut, ja, sehr gut, sie weiß, worüber sie schreiben will und setzt das in die Tat um. “Tinder Press”, ihr amerikanischer Verlag, fügt dem Titel auf Amazon noch einen Doppelpunkt und die Worte “The heartstopping story that will live with you forever" hinzu und die New York Times Bestsellerliste hat einen neuen Number-One-Hit.
Und doch: Irgendetwas stimmt nicht.
Justin E. H. Smith ist nicht der Sänger von The Fall, er ist ein Essayist, unter anderem auch hier auf Substack. Er ist Schriftsteller und Philosoph, aber einer von den “Neuen”, Jahrgang 1972 und betreibt sein Geschäft in feiner Abwägung zwischen Breite und Tiefe, will sagen, er ist eher Habermas denn Richard David Precht, nicht konform, aber auch nicht pseudo-nonkonformistisch wie der Perückenträger aus Solingen. Sein jüngstes Werk, aktuell nur auf englisch erhältlich, trägt den Titel “The Internet Is Not What You Think It Is: A History, a Philosophy, a Warning” und beschäftigt sich mit unserer aktuellen Art und Weise, unser Leben zu betreiben. Unvermeidlich in einem solchen Buch ist das Wort “Algorithmus”, der, der unser Leben angeblich bestimmt. Es beschreibt das Phänomen, dass wir heute von Amazon und Google beraten werden, wo wir doch früher von Freunden die neuesten Bücher, Platten, Videos empfohlen bekamen und nicht etwa von Buchhändlern, Plattenverkäufern und Videoverleihs mit großen John-Travolta-Aufstellern in der Tür. Aber natürlich hat sich etwas verändert. Ohne meine Youtube-History regelmäßig zu löschen, würde ich seit fünf Jahren algorithmisch gesteuert nur Talkshows aus dem Achtziger-Jahre-Westfernsehen sehen, in denen zwischen den Kameraeinstellungen gewechselt wird, nicht um mal eine andere Seite vom Kinski zu zeigen, sondern weil zwischen Kamera und dem Erdbeermund Helmut Schmidt sitzt und die Sichtlinie zu qualmt. Justin E. H. Smith lamentiert jedoch nicht den vermeintlichen Kontrollverlust des Konsumenten, er denkt einen Schritt weiter und darüber nach, ob das größte Problem an den “Algorithmen” vielleicht gar nicht sei, dass wir in Bubbles landen und ein Leben lang die gleichen Youtube-Videos schauen müssen. Smith bemerkt eher, und sehr kritisch, dass auf der anderen Seite des Empfangsgerätes, bei den Filmemachern, den Musikern und ja, den Schriftstellerinnen, eine bewusste oder unbewusste Anpassung and den Algorithmus “passiert”, ja, dass es kreativen Menschen, wie er befürchtet, aus verschiedenen Gründen unmöglich sein könnte, sich den Algorithmen nicht anzupassen, dass diese uns die Freiheit und Vielfalt in der Kreativität rauben könnten.
Es sollte klar werden, worauf ich hinaus will. Ich nehme Jeanine Cummins, Autorin von “American Dirt”, proaktiv in Schutz, ich nehme ihr als Autorin jeden Vorwurf der Berechnung; aber das Buch ist ein Paradebeispiel einer innerlichen Algorithmisierung des eigenen Werkes. Ich bin zu hundert Prozent sicher, dass Frau Cummins angesichts der Greuel des aktuellen mexikanischen Alltags empört ist und sicher auch deshalb den Entschluss gefasst hatte, dieses Thema zu verarbeiten. Ihre öffentlich bekannte Biographie enthält Echos ähnlicher Ereignisse, wie im Buch dargestellt. Als der Roman entstanden ist, instrumentalisierte der damalige Präsident Trump den Flüchtlingstrek, der sich von Mittelamerika durch ganz Mexiko bis an die US-amerikanische Südgrenze erstreckte und auf dem zigtausende Menschen auf der Flucht waren. Und natürlich war vor allem “La Bestia” in den Nachrichten zu sehen, “El tren de la muerte”, “Der Todeszug”. Wie gut senden sich doch beeindruckende Bilder kilometerlanger Güterzüge, auf denen Menschen sitzen, an denen Menschen hängen und so versuchen, an die US-amerikanische Grenze zu gelangen. Wie grausam muss das Schicksal sein, solche wahnwitzigen, lebensgefährlichen Wege zu gehen? Das bringt Klicks und mit ein bisschen Manipulation Wählerstimmen. In diesem Umfeld einen hochemotionalen Roman zum Thema zu schreiben erfordert Vorsicht, wenn er gut werden soll. Oder wenigstens authentisch. Oder wenigstens nicht unrealistisch. Jeanine Cummins jedoch hatte ihre Checkliste wohl vorm Beginn des kreativen Prozesses komplett und musste nur noch ihre wirklich gute Schreibe darauf loslassen und es sollte etwas Brauchbares herauskommen:
Ein investigativer Journalist stirbt: check.
Ein Massaker wie in Winslows “Day of the Dogs”: check.
Eine Flucht: check.
“La Bestia”: check.
Was fehlt? Achso, na klar, Busse mit Teenagern, die in Drogenbandencheckpoints geraten: check.
Der Rest ist Folklore und genau die richtige Menge Spanizismen, die man ohne Übersetzung versteht, fürs feeling, you know?
Man ist ungefähr dreißig Prozent im Buch und begreift, dass es das tatsächlich ist. Dass es keinerlei Überraschung geben wird. Man denkt zu Beginn, dass es vielleicht um das Leben als Emigrant in den Vereinigten Staaten gehen wird, die Flucht nur die Einleitung ist, immerhin heißt das Buch “American Dirt” und nicht “Tierra mexicana”. Aber, nach zweihundert Seiten Klischee und endlosen Absätzen in denen uns die Autorin immer wieder erklärt, wie sehr Lydia trauert, mit Rückblenden an ihr früheres “schönes” Leben, so als würden wir als Leserinnen das nicht beim ersten, zweiten oder .. achten mal verstanden haben, dazu einem abstrusen Handlungsstrang, den wir hier mal nicht spoilern wollen, und wenn es sich immer mehr abzeichnet, dass es um “La Bestia” gehen wird, den Füchtlingsgüterzug, fragt man sich ungläubig: “Echt? Really? Verdaderamente?”, pardon my spanish.
Ja, diese Idee hatte Frau Cummins: Die Protagonistin, Frau eines Journalisten und Besitzerin einer Buchhandlung, die aus dem modernen Kleinbürgertum gerissene Lydia Perez, mit 10.000 Dollar, nicht Peso, Dollar, amerikanischen, in Cash in the Täsch, auf der Flucht vor dem Kartell, springt, nicht einmal, nein, mehrmals, mit ihrem achtjährigen Sohn auf den fahrenden Flüchtlingsgüterzug “La Bestia”. Sie nimmt sich kein Mietauto (oder kauft sich einfach eines) oder ein Flugticket oder begibt sich auf eine Kreuzfahrt, oder, oder, oder.. Nein. Sie hat ein durchschnittliches mexikanisches Jahresgehalt in bar in der Tasche und springt von Autobahnbrücken auf fahrende Züge. Mit einem achtjährigen Sohn an der Hand. Ok, ich bin so ziemlich der inkompetenteste Kommentator dieser Handlungsentscheidung, weiß, männlich, komplett unbedroht und zehntausend Kilometer entfernt und ich lehne mich entsprechend ganz weit aus dem Fenster, wenn ich sage: “No. F*****g. Way.”
Aber vielleicht bin ich ein kompletter Idiot und das ist wirklich der beste oder der einzige Weg der Verfolgung durch ein mexikanisches Drogenkartell zu entkommen. Ok, Jeanine Cummins, aber dann erkläre es mir bitte, das ist dein Job als Autorin. Gehe mit mir die Optionen durch, erkläre es mir wie Deinem achtjährigen Sohn! Oh. Dem Du es auch nicht erklärst. Nein, die Entscheidung, wie es nach der Flucht aus der Provinz um Acapulco und dem unmittelbaren Zugriff durch das Kartell “Los Jardineros” weitergeht, wird auf einer Seite abgehandelt: “Das Kartell sucht nach uns. Man erkennt uns auf der Straße, ”halcones”, Falken, bezahlte Informanten des Kartells, halten nach uns Ausschau. ‘La Bestia’ fährt durch das Gebiet, in denen die “Los Jardineros” keine Falken haben. Ergo: ‘La Bestia’ ist der einzig verbleibende Fluchtweg.”
Warum ich mich so über diese Plotentscheidung aufrege? Die Fahrt auf “La Bestia” dauert das halbe Buch. Es passiert nichts anderes. Und das merkt auch Jeanine Cummins. Das Buch droht langweilig zu werden und ohne den Plot zu ändern, bleibt nur eines, um den Leser immer wieder bei der Stange zu halten: emoción! Muchos emociónes! Grande emoción!
Der US-amerikanische Musiker und Podcaster John Roderick, dem ich mit einer gewissen Devotion folge (und hier ganz nebenbei empfehle) ist Anfang Fünfzig und hat eine Tochter in etwa dem gleichen Alter wie der kleine Luca in “American Dirt”. In einer Episode seiner zahlreichen Podcasts postulierte er kürzlich, dass, seit er selber ein Kind habe, er eines in Film und TV nicht mehr ertrage: wenn Kinder in Gefahr gebracht werden. Früher hätte es ihm nichts ausgemacht, heute jedoch, als Vater, sei es unerträglich. Er finde es billig, einen grausamen Taschenspielertrick auf Kosten des Rezipienten, und die Lektüre von “American Dirt” bringt mich dieser Argumentation näher. Jede Autorin kann natürlich schreiben, was sie will, die Grenzen sind für mich weit, nahezu unendlich. Du willst über Sodomie schreiben, übers Kotzen, Scheißen, Wichsen, go for it, dein Privatvergnügen und das findet im Allgemeinen ein Publikum. Aber, sobald Du in Deinen Werken moralischen Anspruch transportierst endet die Freizone. Hier musst Du Dich als Autor im Gegenzug mit moralischen Ansprüchen des Lesers auseinandersetzen und diesen genügt das aufs Spiel setzen des Sohnes der flüchtenden Lydia, einzig um den Leser bei der Stange zu halten, nicht. Zumal, berechenbar wie das Buch ist, jeder Leser weiß, dass Luca nicht sterben wird. Es wird ein anderer, fast gleichaltriger Junge sein, der den Trek nicht überlebt, und hier, vielleicht überraschend, habe ich keinerlei moralische oder inhaltliche Bedenken im Angesicht dieser grausamen Wendung. Es kommen auf der Flucht aus Mittelamerika in die USA, und, schlimmer, auch nach dieser, Minderjährige um, und das zu thematisieren ist berechtigt und wirksam. Es passiert im Roman plötzlich und ist sinnlos wie alles an dieser Fluchtbewegung. Wir trauern um Beto, ein asthmatisches und viel zu kluges Waisenkind aus den Slums von Tijuana und sind moralisch empört. Und wissen gleichzeitig, dass Luca nun erst recht nicht sterben wird, also, liebe Jeanine, verschone uns mit der zehnten Situation, wo Dir kein Spannungsbogen einfällt und Du uns nur billig Angst machen möchtest. Denn man kann so kinderlos sein, wie man will, die Angst vor dem Verlust des Nachwuchses ist fest einprogrammiert, wenn wir sowas sehen, hören, lesen, krampft der Magen, schluckt der Adamsapfel. Es ist die stärkste und damit die billigste Waffe, den Leser bei der Stange zu halten.
Und hier liegt auch der Unterschied zu Don Winslows Kartell-Trilogie: Ja, die Massaker dort sind noch entsetzlicher, die blutigen Enden mehr oder weniger liebgewonnener Handelnder zahlreich, aber sie sind immer entweder handlungsnotwendig oder, so grausam das ist, Hintergrund, Bebilderung. Sie sind also zwingend. Wir haben bei Winslow daher immer die Wahl, emotional zu reagieren oder rational, empört oder lakonisch, entsetzt oder achselzuckend. Diese Wahl lässt uns Jeanine Cummins nicht, sie schreibt einen emotionalen Verkehrsunfall und keiner kann wegschauen.
Und so ist “American Dirt” leider nur ein Buch, das hätte gut sein können. Na klar, Bestsellerliste, Millionenerfolg - das muss man erstmal hinbekommen und das schafft man im Allgemeinen nicht mit einem Groschenroman. Oder aber eben doch? Einfache Sprache, ein Handlungsstrang, der keine großen Kenntnisse von Lage und Gebiet braucht, jedes Klischee des Settings bis aufs I-Tüpfelchen vorgebracht und viel, viel Kitsch und Emotion - fertig ist der Bestseller. Wir lernen kaum Neues, es werden keine überraschenden Perspektiven eingenommen und das ist so unendlich schade. Denn, wo es große Gegensätze gibt, zwischen Gut und Böse, zwischen Reich und Arm, in Landschaft und Meteorologie, gibt es unendlich Stoff, den zu entdecken und verarbeiten es lohnt. Jeannine Cummins jedoch ging den einfachen Weg - und ich den damit schweren, weil gleichzeitig langweiligen und emotional grausamen durch dieses Buch - damit Ihr das nicht tun müsst.
In den nächten zwei Episoden von Studio B - Lobpreisung und Verriss wird zunächst Anne Findeisen und danach Irmgard Lumpini “American Dirt” rezensieren und sicher zu anderen, interessanten Schlüssen kommen. Ich werde die Zeit nutzen, mich mit Geschichte, Gegenwart und Zukunft von “cultural appropriation” zu beschäftigen und versuchen herauszubekommen, was “kulturelle Aneignung” eigentlich sein soll, denn das wird spätestens zur Diskussion zum Buch abgefragt werden.
Spannende Wochen!
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Studio B Sommerklassiker: Kehlmann, Berg, Tchaikovsky
dimanche 4 septembre 2022 • Duration 42:53
Im Sommer 2019, man erinnert sich, als die Welt noch komplett in Ordnung war, schrieben wir folgendes (die Links im Text führen direkt zu den Rezensionen auf Soundcloud):
Dass Herr Falschgold etwas völlig anderes unter einem Brainfuck versteht als Sibylle Berg wurde spätestens in der Diskussion zur heutigen Sendung klar. Aber man hätte es schon ahnen können, als Irmgard Lumpini von Frau Bergs aktuellem Buch „GRM: Brainfuck.“ zwar geflasht war, aber trotz tiefschwarzer Dystopie sehr angetan. Herr Falschgolds Brainfuck-Moment kam spätestens als er bemerkte, dass Adrian Tchaikovsky in seinem 2014 erschienenen Roman „Children of Time“/“Kinder der Zeit“ den Feminismus unserer Gesellschaft aus der Sicht von Spinnen analysiert. Und dass es der Hauptheld in Daniel Kehlmanns Durchbruch „Ich und Kaminski“ kopfmässig auch nicht leicht hat, tat dem Vergnügen, welches Anne Findeisen bei der Lektüre hatte keinerlei Abbruch – im Gegenteil.
Uns so konnte das Kollektiv anschließend nur Lobpreisungen konstatieren und ließ sich von dieser positiven Stimmung zu tiefgründiger, ziviler und wirklich hörenswerter Diskussion verleiten.
Wir wiederholen.
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Studio B Sommerklassiker: Lisa Jewell - The Girls in the Garden
dimanche 28 août 2022 • Duration 06:08
Noch ist der Sommer nicht vorbei: Spannende Lektüre, Gesellschaftskritik und Tiefgang mit Leichtigkeit. Gönnt Euch diesen Sommerklassiker!
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com
Studio B Sommerklassiker: Michael Wolff - Feuer und Zorn: Im Weißen Haus von Donald Trump
dimanche 21 août 2022 • Duration 05:35
Wir sind im August alle im Urlaub, wie man sich das in Deutschland so leistet. Völlig unbekannt ist diese uns so selbstverständlich scheinende Einrichtung in den Staaten, den vereinigten, denen von Amerika. Anne Findeisen warf in 2018 einen Blick auf diese und ihren damaligen Präsidenten, einen gewissen Herrn Trump und was not amused.
Sie schrieb damals:
„Der Wahlsieg Donald Trumps ist sicherlich von vielen Menschen unterschiedlichster Schichten und Herkunft mit Bestürzung aufgenommen worden. Doch nachdem man sich langsam damit abgefunden hat, dass es sich bei seiner Präsidentschaft nicht um einen Irrtum handelt, lässt einen dieses Buch erneut Kopfschüttelnd zurück. Bereits auf den ersten hundert Seiten berichtet Michael Wolff so Ungeheuerliches, dass man sich erneut zu fragen beginnt, wie es sein kann, dass eine Person wie Trump, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde.“
Jetzt gerade ist sie in den damals von diesem Idioten beherrschten Staaten und gleicht das Gelesene mit der Realität ab. Damit sie dabei nicht gestört wird, heute also diese Wiederholung.
This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit lobundverriss.substack.com