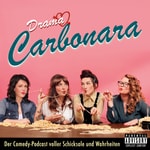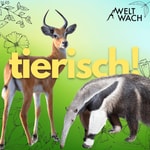biophon - Geschichten aus Biowissenschaft und Forschung – Details, episodes & analysis
Podcast details
Technical and general information from the podcast's RSS feed.
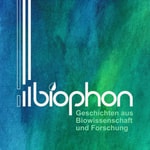
biophon - Geschichten aus Biowissenschaft und Forschung
biophon
Frequency: 1 episode/24d. Total Eps: 45

Recent rankings
Latest chart positions across Apple Podcasts and Spotify rankings.
Apple Podcasts
🇩🇪 Germany - naturalSciences
28/07/2025#95🇩🇪 Germany - naturalSciences
22/07/2025#86🇩🇪 Germany - naturalSciences
16/07/2025#80🇩🇪 Germany - naturalSciences
15/07/2025#59🇩🇪 Germany - naturalSciences
14/07/2025#41🇩🇪 Germany - naturalSciences
13/07/2025#25🇩🇪 Germany - naturalSciences
07/07/2025#91🇩🇪 Germany - naturalSciences
06/07/2025#74🇩🇪 Germany - naturalSciences
05/07/2025#61🇩🇪 Germany - naturalSciences
04/07/2025#51
Spotify
No recent rankings available
Shared links between episodes and podcasts
Links found in episode descriptions and other podcasts that share them.
See all- https://support.biophonpodcast.de
45 shares
- http://support.biophonpodcast.de/
45 shares
- https://www.organspende-info.de/
26 shares
RSS feed quality and score
Technical evaluation of the podcast's RSS feed quality and structure.
See allScore global : 72%
Publication history
Monthly episode publishing history over the past years.
bp43: Zusammen wachsen - Über die Domestikation unserer Kulturpflanzen
Season 2 · Episode 43
samedi 9 décembre 2023 • Duration 01:22:33
50% ihrer Kalorien bezieht die Weltbevölkerung aus nur drei Gräsern: Weizen, Mais, und Reis. Vor ungefähr 10 000 Jahren waren es die Vorfahren dieser Pflanzen, die unsere steinzeitlichen Ahnen zur Sesshaftigkeit erzogen, und sich im Gegenzug domestizieren liesen. Seitdem dreht sich unsere Zivilisation um die Kultivierung von Pflanzen. Höchste Zeit also, dass wir uns die ganze Sache im zweiten Teil unserer Miniserie über Domestikation einmal genauer anschauen! Was hat es zum Beispiel mit Apikaldominanz, Ährenbrüchigkeit und Ähnlichem zu tun, und warum kommt keine Getreidesorte ohne diese Eigenschaft aus? Warum wurden einige Pflanzen domestiziert, und andere nicht? Und aus welcher Ecke der Welt stammt eigentlich welches Gewächs? Wie wichtig es für uns ist, dass die Menschheit und ihre grünen Schützlinge weiterhin zusammen wachsen, zeigt uns nicht nur eine Episode aus der Sowjetunion, sondern auch die aktuellen Debatten um Klimawandel und Gentechnik. In diesem Sinne - wir sind, was wir essen, aber wir essen auch, was wir sind: Außerordentlich domestiziert.
Quellen
Crow, James F. "NI Vavilov, martyr to genetic truth." Genetics 134.1 (1993): 1.
GAG155: Trofim Lysenko und der Lysenkoismus der Sowjetunion
Crop Domestication: why only wheat, maize and rice? Talk by Dr. Mark Chapman for the Gatsby Plant Science Education Programme, 02. 11.2022
Doebley, John, Adrian Stec, and Lauren Hubbard. "The evolution of apical dominance in maize." Nature 386.6624 (1997): 485-488.
Fang, Zhou, and Peter L. Morrell. "Domestication: Polyploidy boosts domestication." Nature plants 2.8 (2016): 1-2.
Piperno, Dolores R., et al. "Experimenting with domestication: Understanding macro-and micro-phenotypes and developmental plasticity in teosinte in its ancestral pleistocene and early holocene environments." Journal of Archaeological Science 108 (2019): 104970. Bildquelle für
V. Nanjundiah, R. Geeta, and V. V. Suslov. "Revisiting NI vavilov’s “The law of homologous series in Variation”(1922)." Biological Theory 17.4 (2022): 253-262.
"Von Kreuzen bis Genome Editing: Die Verfahren der Pflanzenzüchtung im Überblick", https://www.transgen.de/, 06.12.2023
Bildquellen:
Nikolai Vavilov, Russian botanist and geneticist, Public domain, Via Wikimedia commons
Soviet pseudoscientist Trofim Denisovich Lysenko , Public domain, Via Wikimedia commons
Teosinte and Maize, Figure 1 aus Doebley, John, et al. "Genetic and morphological analysis of a maize-teosinte F2 population: implications for the origin of maize." Proceedings of the National Academy of Sciences 87.24 (1990): 9888-9892.
Polyploidy, Figure 1 aus Fang, Zhou, and Peter L. Morrell (siehe Quellen)
Apikaldominanz in Teosinte, Figure 5 aus
--------------
Wer uns unterstützen möchte (Danke!), hat hier die Möglichkeit dazu: support.biophonpodcast.de
bp42: Fleischfressende Pflanzen - Pflanzen, die Tiere fressen (und für sich fressen lassen)
Season 1 · Episode 42
mercredi 21 juin 2023 • Duration 01:46:46
Pflanze „frisst“ Sonne, Tier frisst Pflanze, Tier frisst Tier. So kennen wir das, so soll das sein. Dass die Biologie so ist, wie sie ist und sich nicht an solche Regeln hält irritierte schon Carl von Linné, seines Zeichens Biologie-Superstar, vor über 250 Jahren. Erst 100 Jahre später wagte sich Charles Darwin — ebenfalls Biologie-Superstar — wissenschaftlich fundiert zu postulieren: „Pflanze frisst Tier“ ist sehr wohl möglich. Mittlerweile zweifelt keiner mehr daran, dass es Pflanzen gibt, die sich von Tieren ernähren. Aber warum ist das so? Was bringt einen Organismus, der seine Energie aus der Fotosynthese gewinnt dazu, aufwendige Fangmethoden zu entwickeln, um Tiere zu erbeuten? Wir tauchen in dieser Folge tief in die Grundlagen des Stoffwechsels ein und beleuchten die Biologie der faszinierenden fleischfressenden Pflanzen, die viele von uns sicherlich schon im Kinderzimmer stehen hatten. Warum hinter diesen Organismen mehr steckt als ein nettes Geschenk für Kinder, welche grandiosen Fangmethoden sie entwickelt haben und inwiefern von ihnen Gefahr für uns ausgeht: Darum gehts in Folge bp42.
Quellen
Spencer, Edmund (26–28 April 1874). "Crinoida Dajeeana, The Man-eating Tree of Madagascar" (PDF). New York World.
Rost, K., & Schauer, R. (1977). Physical and chemical properties of the mucin secreted by Drosera capensis. Phytochemistry. https://doi.org/10.1016/S0031-9422(00)88783-X
Catapulting Tentacles in a Sticky Carnivorous Plant (Videos der Katapult-Tentakel): https://naturedocumentaries.org/5072/catapulting-tentacles-carnivorous-plant-hartmeyer-2012/
Suda, H. et al. (2020). Calcium dynamics during trap closure visualized in transgenic Venus flytrap. Nature Plants. https://doi.org/10.1038/s41477-020-00773-1
Forterre, Y. et al. (2005). How the Venus flytrap snaps. Nature. https://doi.org/10.1038/nature03185
Chase, M. W. et al. (2009). Murderous plants: Victorian Gothic, Darwin and modern insights into vegetable carnivory. Botanical Journal of the Linnean Society. https://doi.org/10.1111/j.1095-8339.2009.01014.x
Cross, A. T. et al. (2022). Capture of mammal excreta by Nepenthes is an effective heterotrophic nutrition strategy. Annals of Botany. https://doi.org/10.1093/aob/mcac134
Bildquellen
Coverbild: NoahElhardt, Drosera capensis bend, CC BY-SA 3.0
Sonnentau: Denis Barthel, DroseraPeltataLamina, CC BY-SA 3.0
Kannenpflanze: Alex Lomas, Nepenthes maxima × sanguinea (2943627683), CC BY 2.0
Saugfallen: Liliane ROUBAUDI, Utricularia australis traps (03), CC BY-SA 2.0 FR
Venusfliegenfalle: Tippitiwichet, Venus Flytrap 020, CC BY 2.0
--------------
Wer uns unterstützen möchte (Danke!), hat hier die Möglichkeit dazu: support.biophonpodcast.de
bp33: Ein Herz aus Schwein - über die Biologie von Transplantation und Abstoßung
Season 1 · Episode 33
dimanche 8 mai 2022 • Duration 01:25:16
So ganz nebenbei ereignete sich im Januar 2022 eine medizinische Sensation: Einem Team der Universität Maryland, USA, gelang es, dem 57-Jährigen David Bennett, der an terminaler Herzinsuffizienz litt, ein Spenderherz zu transplantieren. Das Besondere daran: Das Organ stammte von einem Schwein. Und David überlebte damit ganze zwei Monate. Aber warum genau ist das eigentlich so schwierig, dieses Transplantieren, liegt doch die Grundidee vom Austausch defekter Organe schon seit vorchristlichen Jahrhunderten quasi auf der Hand? Im bewährten biophon-Dreiklang von Definition, Geschichte und Funktionsweise beschäftigen wir uns in dieser Folge mit der Immunbiologie von Transplantation und Abstoßung. Diese beruht auf einem grundlegenden Funktionsprinzip unseres Immunsystems: der Fähigkeit, zu erkennen, was immunologisch gesprochen "selbst" und "fremd" und was "harmlos" und "gefährlich" ist. Wer also schon immer mal wissen wollte, wie ein T- Zell- Trainingslager aussieht, was man alles an einem Schwein verändern musste, bevor sein Herz auf einen menschlichen Empfänger verpflanzt werden konnte, und warum ist der Fall David Bennett als absolute Erfolgsgeschichte im Feld der Xenotransplantation einzustufen ist, dem sei diese Folge ans Herz gelegt. Die enthaltenen Informationen sind garantiert mit allen Blutgruppen kompatibel.
Quellen
"Pioneering Transplant of Porcine Heart into Adult Human Heart Disease", Pressemitteilung der Universität Maryland, 10.01.2022.
"Der falsche Patient für die richtige Sache", Zeit online, 27.04.2022.
"The gene-edited pig heart given to a dying patient was infected with a pig virus", MIT Technology review, online, 04.05.2022.
Dai, Yifan, et al. "Targeted disruption of the α1, 3-galactosyltransferase gene in cloned pigs." Nature biotechnology 20.3 (2002). DOI: https://doi.org/10.1038/nbt0302-251
"The 10-gene pig and other medical science advances enabled UAB’s transplant of a pig kidney into a brain-dead human recipient" , The University of Alabama at Birmingham, online, 20.01.2022.
Bildquellen
Cover: "Anatomical heart vector illustration", Public domain licence, https://publicdomainvectors.org/en/free-clipart/Anatomical-heart-vector-illustration/16675.html
DR. BARTLEY GRIFFITH & DAVID BENNETT JAN 2022, University of Maryland, öffentlich verfügbares Pressematerial
Links
Fragen zur Knochenmarksspende: https://www.dkms.de/faq
Fragen zur Organspende: https://www.organspende-info.de/
Fragen zur Blutspende: https://www.blutspende.de/blutspende/haeufig-gestellte-fragen-faq
--------------
Wer uns unterstützen möchte (Danke!), hat hier die Möglichkeit dazu: support.biophonpodcast.de
bp32: Intelligente Tiere - Ungeordnete Liste einiger nach menschlichen Standards ziemlich cleverer Tiere
Season 1 · Episode 32
dimanche 24 avril 2022 • Duration 01:55:31
Was ist eigentlich Intelligenz? Biologinnen und Biologen tun sich mit dieser Frage schwer. Dennoch sind wir es, auf die man blickt, wenn es um die Beurteilung der Intelligenz von Tieren geht, die keine Menschen sind. Immerhin, nachvollziehbar finden wir die Frage - spannend allemal. Zeit also, uns einmal auf die Suche nach Antworten zu begeben. Welches Tier kann am besten rechnen? Welches Tier hat den höchsten IQ? Ist mein Fifi schlauer als Nachbar’s Lumpi? Wer das wissen möchte ist auf unzähligen Webseiten mit mehr oder weniger populistischen „Nummer-7-wird-Dich-umhauen-Listen“ besser aufgehoben. Wir versuchen, uns dem Thema mal wissenschaftlich zu nähern und beginnen damit zu erklären, dass man das Thema eigentlich garnicht wirklich wissenschaftlich erklären kann. Dennoch: mit dem in der langen Einleitung dieser Folge erläuterten Mindset können wir dann doch ein paar erstaunliche Fakten über die kognitiven Fähigkeiten vieler Tiere erzählen und in einer ungeordneten „Hitliste“ zusammenfassen. Dabei stellen wir auch gleich den ein oder anderen Mythos richtig und verhelfen hoffentlich zahlreichen zu Unrecht unterschätzten Tierarten zu mehr Respekt. Wer wissen möchte, wie man einem Fisch Fahrstunden gibt, welches erstaunliche Jagdverhalten einige Spinnen zeigen und warum das intelligenteste nicht-menschliche Tier diesen Titel (möglicherweise) garnicht (allein) verdient, der sei herzlich zu dieser Folge eingeladen.
Quellen
Pterosaurier mit Federn: [1]
NationalGeographics-Artikel: [2]
Eichhörnchen: [3]
Waschbären: [4]
Fahrstunden für Goldfische: [5]
Ratten: [6], [7]
Hunde: [8]
Oktopoden: [9]
Affen: [10]
Vögel: [11]
Bildquellen
Termitenhügel: J Brew, Cathedral Termite Mound - brewbooks, CC BY-SA 2.0
Portia (Spinne): Donald Hobern from Copenhagen, Denmark, Portia fimbriata (15235249464), CC BY 2.0
Ratte: Dunpharlain, Brown Rat (Rattus norvegicus), CC BY-SA 4.0
Oktopus: Nick Hobgood, Octopus shell, CC BY-SA 3.0
Buschhäher: Cephas, Cyanocitta cristata CT,
--------------
Wer uns unterstützen möchte (Danke!), hat hier die Möglichkeit dazu: support.biophonpodcast.de
bp31: Biolumineszenz - Wenn der Natur ein Licht aufgeht
Season 1 · Episode 31
dimanche 10 avril 2022 • Duration 01:13:00
Wo Licht ist, ist auch Schatten. So viel ist klar. Da aber jede Regel auch eine Außnahme braucht, ist manchmal auch gerade da, wo Schatten ist, Licht. In tiefen Hölen, zum Beispiel. In Mooren bei Nacht. Oder in der Tiefsee. Dort finden sich Lebewesen, die wortwörtlich aus sich selbst heraus leuchten. Dieses Phänomen wird als Biolumineszenz bezeichnet, und ist weiter verbreitet, als man im ersten Moment annehmen könnte. Pilze, Fische, Bakterien, Käfer, Fliegenlarven und sogar Haie - unter ihnen allen gibt es biolumineszente Arten, die das Leuchten im Laufe der Evolution immer wieder neu für sich entdeckt haben. Und obwohl viele Wege zum Leuchten führen, ist das prinzipielle Funktionsprinzip immer das gleiche. Wie genau Biolumineszenz funktioniert, wie Licht eigentlich entsteht, und warum man diese Prinzipien auch ganz wunderbar im Labor anwenden kann, klären wir in dieser Folge. Mit dabei: Leuchtende Flitterwochen, ein Nobelpreis, Darwin, der außnahmsweise mal nicht Recht hatte, und natürlich das ewige Standard- Leuchtprotein GFP. Licht aus, Augen auf!
Quellen
Mallefet, J., Stevens, D. W., & Duchatelet, L. (2021). Bioluminescence of the largest luminous vertebrate, the kitefin shark, Dalatias licha: first insights and comparative aspects. Frontiers in Marine Science, DOI: https://doi.org/10.3389/fmars.2021.633582
Shimomura, O., Johnson, F. H., & Saiga, Y. (1962). Extraction, purification and properties of aequorin, a bioluminescent protein from the luminous hydromedusan, Aequorea. Journal of cellular and comparative physiology, DOI: https://doi.org/10.1002/jcp.1030590302
Shimomura, Osamu. "Discovery of green fluorescent protein (GFP)(Nobel Lecture)." Angewandte Chemie International Edition 48.31 (2009), DOI: https://doi.org/10.1002/anie.200902240
Bildquellen
Kopf des Schokoladenhais mit großen Augen, kurzer Schnauze und dicken Lippen, Wikimedia commons, CC BY 2.0
Weibchen des Großen Leuchtkäfers (Lampyris noctiluca) beim nächtlichen Lock-Leuchten, Wikimedia commons, CC BY-SA 2.0 de
Glow worms, flickr, CC BY-NC-ND 2.0
This long-exposure photo shows the bioluminescence of Noctiluca scintillans in the yacht port of Zeebrugge, Belgium, Wikimedia commons, CC BY-SA 4.0
Gigantactis sp., Wikimedia commons, CC BY 3.0
Grün fluoreszierendes Protein, Wikimedia commons, CC BY-SA 3.0
--------------
Wer uns unterstützen möchte (Danke!), hat hier die Möglichkeit dazu: support.biophonpodcast.de
bp30: Gift - Warum man einige Dinge besser nicht isst und was passiert, wenn man es doch tut
Season 1 · Episode 30
vendredi 18 mars 2022 • Duration 01:45:35
Schokolade ist giftig. Wasser auch. Beide Aussagen stimmen, müssen aber dennoch etwas differenziert betrachtet werden. Denn wenn man nicht gerade zehn Kilogramm eines der beiden Stoffe zu sich nimmt, ist man auf der sicheren Seite - als Mensch. Andere Tiere sollten hingegen garnicht in den Genuss von zumindest Schokolade kommen, sind dafür aber gegen Substanzen unempfindlich, von denen wir als Menschen besser Abstand halten sollten. Man merkt, es nicht nicht einfach zu definieren, was giftig ist und was nicht. Wir versuchen dennoch ein bisschen Ordnung in das Wirrwarr der Faktenschnipsel zum Thema „Gift“ zu bringen und schauen uns an, wie bekannte Gifte wirken, welche Folgen ihr Konsum hat und was man dagegen unternehmen kann. Natürlich kommen wir dabei nicht umhin, die giftigsten Pflanzen Europas vorzustellen, Tiere zu erwähnen, von denen man nicht denken würde, dass sie giftig sind und einen (in keinster Weise despektierlich gemeinten) Ausflug nach Australien zu machen. Wer wissen möchte, unter welchen Bäumen man sich bei Regen besser nicht unterstellt, wie man Brennnesseln streichelt und warum man selbiges bei Baumsteigerfröschen besser nicht tut und was Zigaretten mit Fliegenpilzen gemeinsam haben ,sei hiermit herzlich zum garantiert ungefährlichen Konsum von Folge bp30 eingeladen. Übrigens - nur um das nochmal zu erwähnen: Ärzte sind wir nicht, und medizinischen Rat können wir nicht geben.
Bildquellen
Fliegenpilz: Daffman, Großer Fliegenpilz, CC BY-SA 3.0 DE
Kreuzotter: Václav Gvoždík, Vipera berus01, CC BY-SA 2.5
Blauer Eisenhut: Helge Klaus Rieder, Blauer Eisenhut Roscheiderhof H3a, CC0 1.0
Paternostererbse: Vinayaraj, Abrus precatorius - jequirity bean near Tenkasi 2014 (2), CC BY-SA 4.0
--------------
Wer uns unterstützen möchte (Danke!), hat hier die Möglichkeit dazu: support.biophonpodcast.de
bp29: Wann ist ein Baum ein Baum?
Season 1 · Episode 29
vendredi 4 mars 2022 • Duration 57:35
Überall im Stammbaum der Pflanzen, zwischen Kräutern, Blumen, Gras und Sträuchern, taucht die Wuchsform "Baum" immer wieder unabhäng auf. Hättet ihr zum Beispiel gedacht, dass ein Apfelbaum enger mit einer Brennessel verwandt ist, als mit einer Platane? Ein "Baum" - also eine große, holzige, langlebige Pflanze - ist somit eher als eine Wachstumsstrategie zu bezeichnen, anstatt als Pflanzenfamilie. Doch was genau macht die Strategie "Baum" aus? Oder, anders gefragt, wann ist ein Baum ein Baum? Um diese Frage zu beantworten, steigen wir tief ein in die Botanik und klären grundlegende Sachen wie: was ist eigentlich Holz? Wozu braucht man sekundäres Dickenwachstum? Und warum sind Palmen eher großes Gras als echte Bäume? Um die Verwirrung komplett zu machen, lernen wir außerdem, dass man ausgesprochen krautige Kräuter in nur wenigen Schritten dazu überreden kann, zu "baumen" und Holz anzusetzen. Ist das jetzt Biologie oder Quatsch? Hört selbst - und denkt daran: ein Baum ist quasi das Gleiche wie ein Fisch.
Quellen
The Eukaryote`s Writers Blog: there is no such thing as a tree. 2022. https://eukaryotewritesblog.com/2021/05/02/theres-no-such-thing-as-a-tree/
Knowable magazine: What makes a tree a tree? 2022. https://knowablemagazine.org/article/living-world/2018/what-makes-tree-tree
Melzer, Siegbert, et al. "Flowering-time genes modulate meristem determinacy and growth form in Arabidopsis thaliana." Nature genetics (2008). DOI: https://doi.org/10.1038/ng.253
Groover, Andrew T. "What genes make a tree a tree?." Trends in plant science 10.5 (2005). DOI: 10.1016/j.tplants.2005.03.001
Ballard Jr, Harvey E., and Kenneth J. Sytsma. "Evolution and biogeography of the woody Hawaiian violets (Viola, Violaceae): Arctic origins, herbaceous ancestry and bird dispersal." Evolution (2000) . DOI: https://doi.org/10.1111/j.0014-3820.2000.tb00698.x
Bildquellen
Verholzte A. thaliana: From Melzer, Siegbert, et al. "Flowering-time genes modulate meristem determinacy and growth form in Arabidopsis thaliana."
Baumartiges Veilchen: From Ballard Jr, Harvey E., and Kenneth J. Sytsma. "Evolution and biogeography of the woody Hawaiian violets (Viola, Violaceae): Arctic origins, herbaceous ancestry and bird dispersal."
--------------
Wer uns unterstützen möchte (Danke!), hat hier die Möglichkeit dazu: support.biophonpodcast.de
bp28: Bakteriophagen - Biologie und Potenzial der unterschätzten Bakterienfresser
Season 1 · Episode 28
vendredi 11 février 2022 • Duration 01:29:23
Sie sind unter uns, um uns herum und in uns. Und sie sind gefährlich, wenn auch nicht für uns. In einer Welt, die so klein ist, dass wir sie nicht sehen können tobt ein Krieg zwischen den ganz kleinen und den noch kleineren: Bakteriophagen sind Viren, die Bakterien befallen. Ihre Existenz ist fast so lange bekannt wie die Existenz humanpathogener Viren, außerhalb der Biologie kennt man sie dennoch vorrangig als „übriggebliebenen Faktenschnipsel“. Wir finden, das reicht nicht - denn ihre Biologie ist faszinierend und ihre potenziellen Anwendungsmöglichkeiten bis heute weit unterschätzt. Die in der Übersetzung trefflich „Bakterienfresser“ genannten Viren befallen ihre Wirtsbakterien hoch spezifisch und töten sie in der Regel. Ihre Effizienz und ihre Spezifität machen sie daher zu einer starken Waffe im Kampf gegen pathogene Bakterien - ob im menschlichen Körper, der Humandiagnostik, der Gentechnik oder gar der Lebensmittelindustrie. Grund genug, die faszinierenden „mondfährenartigen Wesen“ einmal genauer unter die sehr, sehr starke Lupe zu nehmen.
Quellen
Zhao, Y. et al.(2013). Abundant SAR11 viruses in the ocean. Nature. https://doi.org/10.1038/nature11921
Hershey, A. D., & Chase, M. (1952). Independent functions of viral protein and nucleic acid in growth of bacteriophage. The Journal of general physiology. https://doi.org/10.1085/jgp.36.1.39
Hofer, B. (2013). Konservieren mit Viren. heise online. Stand: Feb. 2022. https://www.heise.de/hintergrund/Konservieren-mit-Viren-1809197.html
Soothill, J. S. (1994). Bacteriophage prevents destruction of skin grafts by Pseudomonas aeruginosa. Burns. https://doi.org/10.1016/0305-4179(94)90184-8
McVay, C. S., Velásquez, M., & Fralick, J. A. (2007). Phage therapy of Pseudomonas aeruginosa infection in a mouse burn wound model. Antimicrobial agents and chemotherapy. https://doi.org/10.1128/AAC.01028-06
Kutateladze, M., & Adamia, R. (2010). Bacteriophages as potential new therapeutics to replace or supplement antibiotics. Trends in biotechnology. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2010.08.001
Dutilh, B. E. et al. (2014). A highly abundant bacteriophage discovered in the unknown sequences of human faecal metagenomes. Nature communications. https://doi.org/10.1038/ncomms5498
Bildquellen
Coverbild: Dr. Victor Padilla-Sanchez, PhD, T4 Bacteriophage, CC BY-SA 4.0
Aufbau Bakteriophage: Adenosine, PhageExterior, CC BY-SA 3.0
Bakteriophagen, Mikroskopische Aufnahme: AFADadcADSasd, Bacteriophage, CC BY 4.0
--------------
Wer uns unterstützen möchte (Danke!), hat hier die Möglichkeit dazu: support.biophonpodcast.de
bp27: Mini - Gehirne - Was uns cerebrale Organoide über uns selbst verraten
Season 1 · Episode 27
vendredi 21 janvier 2022 • Duration 01:07:42
Es scheint sich sich langsam, aber zielsicher eine neue biophonb-Kategorie herauszubilden: Ist das Science oder Fiction? Wenn winzige Zellklumpen zum Beispiel plötzlich in der Lage dazu sind, den Experimentierenden aus ihrer Petrischale heraus zu beobachten, dann ist das definitiv Fiction. Oder? Jedenfalls haben wir noch nicht genug von synthetischer Biologie und greifen das Thema der letzten Folge hier einfach nochmal auf, dieses mal aber nicht im Großen, Ganzen, sondern im Kleinen, Speziellen. Denn Mini-Gehirne in Form von cerebralen Organoiden, ob mit oder ohne Augen, sind mittlerweile durchaus Science. Was wir alles erfinden mussten, damit Organoide ihren Siegeszug durch die Labore antreten konnten, warum sich darüber ganz besonders die Neurowissenschaft freut, und wie sich die Denkorgane von Maus, Mensch und Schimpanze voneinander unterscheiden, das klären wir hier. Ob Organoide der Forschung irgendwann nicht nur bei der Arbeit zusehen, sondern auch mitdenken werden, das wird die Zukunft zeigen.
Quellen
Gabriel, E., et al. "Human brain organoids assemble functionally integrated bilateral optic vesicles." Cell Stem Cell (2021), DOI: https://doi.org/10.1016/j.stem.2021.07.010
Smaers, JB., et al. "The evolution of mammalian brain size." Science Advances (2021), DOI: DOI: 10.1126/sciadv.abe2101
Nowakowski, TJ., et al. "Transformation of the radial glia scaffold demarcates two stages of human cerebral cortex development." Neuron (2016), DOI: https://doi.org/10.1016/j.neuron.2016.09.005
Takahashi, K., Yamanaka, S. "Induction of pluripotent stem cells from mouse embryonic and adult fibroblast cultures by defined factors". Cell (2006), DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2184.2008.00493.x
Lancaster, MA., et al. "Cerebral organoids model human brain development and microcephaly." Nature (2013), DOI: https://doi.org/10.1038/nature12517
(Coverbild stammt aus dieser Studie)
Kadoshima, T., et al. "Self-organization of axial polarity, inside-out layer pattern, and species-specific progenitor dynamics in human ES cell–derived neocortex." Proceedings of the National Academy of Sciences (2013), DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.1315710110
Benito-Kwiecinski, S., et al. "An early cell shape transition drives evolutionary expansion of the human forebrain." Cell (2021), DOI: https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.02.050
--------------
Wer uns unterstützen möchte (Danke!), hat hier die Möglichkeit dazu: support.biophonpodcast.de
bp26: Synthetische Biologie - Leben aus dem Labor: Fiction oder Science?
Season 1 · Episode 26
vendredi 7 janvier 2022 • Duration 01:27:28
Bereits 1818 beschäftigte sich Mary Shelley mit der Frage, was wohl passieren würde, könnte man Leben im Labor erzeugen. Das Resultat ihrer Überlegungen ist die Geschichte um den vermutlich ersten synthetischen Biologen der Geschichte: Victor Frankenstein. Was als einer der ersten Romane des Science-Fiction-Genres gilt ist heute, 200 Jahre später, zumindest teilweise Realität. Biologinnen und Biologen arbeiten heute vor allem auf der Ebene des Erbguts von Bakterien. Diesen neue Funktionen zu verleihen ist für Gentechnikerinnen und Gentechniker geradezu ein alter Hut - das mit selbst hergestellten, nicht-natürlichen Genen, Proteinen und Stoffwechselwegen zu tun ist aber selbst in Zeiten versierter Technologien und molekularbiologischer Techniken alles andere als selbstverständlich. Wir sind fasziniert vom riesigen Forschungsfeld der synthetischen Biologie, geben einen Überblick über Arbeitsweisen, Methoden und Anwendungen dieser vergleichsweise jungen Wissenschaft und versuchen Antworten auf die Frage zu geben, die zahlreiche Menschen aus Wissenschaft und Literatur seit Jahrhunderten umtreibt: künstliches Leben aus dem Labor - Science oder Fiction?
Quellen
Couzin, J. (2002). Active Poliovirus Baked From Scratch. Science. https://doi.org/10.1126/science.297.5579.174b
Elowitz, M. B., & Leibler, S. (2000). A synthetic oscillatory network of transcriptional regulators. Nature. https://doi.org/10.1038/35002125
Gardner, T. et al. (2000) Construction of a genetic toggle switch in Escherichia coli. Nature. https://doi.org/10.1038/35002131
Martin, V. J. et al. (2003). Engineering a mevalonate pathway in Escherichia coli for production of terpenoids. Nature biotechnology. https://doi.org/10.1038/nbt833
Levskaya, A. et al. 2005). Engineering Escherichia coli to see light. Nature. https://doi.org/10.1038/nature04405
Gibson, D. G. et al. (2010). Creation of a bacterial cell controlled by a chemically synthesized genome. Science. https://doi.org10.1126/science.1190719
Venetz, J. E. et al. (2019). Chemical synthesis rewriting of a bacterial genome to achieve design flexibility and biological functionality. Proceedings of the National Academy of Sciences. https://doi.org/10.1073/pnas.1818259116
Belkin, S. et al. (2017). Remote detection of buried landmines using a bacterial sensor. Nature Biotechnology. https://doi.org/10.1038/nbt.3791
Nguyen, P.Q. et al. (2021). Wearable materials with embedded synthetic biology sensors for biomolecule detection. Nature Biotechnology. https://doi.org/10.1038/s41587-021-00950-3
Bildquellen
Coverbild: „Life, encoded“, pasukaru76 via flickr.com, Public Domain
--------------
Wer uns unterstützen möchte (Danke!), hat hier die Möglichkeit dazu: support.biophonpodcast.de